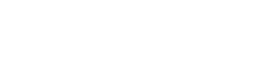In seiner kürzlich veröffentlichten Analyse „Faschistisches Momentum und linker Hoffnungsschimmer“ kommt Janis Ehling, Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, zu einer dramatischen Warnung: Die rechten Demagogen vom Range Trump, AfD und Co. könnten in den nächsten Jahrzehnten den Faschismus errichten. Hinter ihrem Aufstieg stehe laut Ehling eine „gesellschaftliche Blockade“ und ein „konservativer Zeitgeist“. Was steckt hinter Ehlings Sorge?
„Gesellschaftliche Blockade“
Ehling stellt zutreffend fest, dass die tiefe Krise des Kapitalismus stabile Regierungskoalitionen erschwert. Seine Diagnose einer „gesellschaftlichen Blockade“ ist jedoch übertrieben.
Trotz der Krise ist die herrschende Klasse weiterhin in der Lage, ihre Geschäfte durch die bestehenden Institutionen – Parlament, Gerichte, Polizei – abzuwickeln. Nach Trump oder dem Scheitern der Ampel sahen die Herrschenden keinen Anlass, eine Diktatur zu errichten, weil der parlamentarische Betrieb nach wie vor funktioniert, wenn auch mit zunehmender Instabilität. Ehling verwechselt den Anfang eines Prozesses mit seinem vermeintlichen Ende.
Weil Ehling die Gesellschaft nicht aus einer proletarischen Klassenperspektive betrachtet, sondern den bürgerlichen Blickwinkel übernimmt, analysiert er von oben: vom Standpunkt des Parlaments, der Koalitionen oder der Wahlumfragen. Spricht er von einer allgemeinen Blockade der Gesellschaft, müsste er nämlich erklären, warum die Arbeiterklasse blockiert sei. Das tut er nicht.
Dabei erleben wir in den letzten Jahren eine spürbare Zunahme an Klassenkämpfen: wachsende gewerkschaftliche Organisierung, steigender Druck auf die sozialpartnerschaftliche Gewerkschaftsführung sowie eine Zunahme sozialer Bewegungen und ihrer Radikalität, etwa bei Fridays for Future oder in der Palästinabewegung. All das sind Anzeichen eines gesellschaftlichen Aufbruchs, nicht einer Lähmung.
Zugleich entlädt sich die gesellschaftliche Wut auch in der Unterstützung von Kräften wie der AfD oder Trump. Ehling erkennt zwar den reaktionären Kern ihrer Programme, bleibt jedoch die Erklärung schuldig, warum sich diese Wut nicht in der Linkspartei ausdrückt. Der Grund liegt in der Rolle der Führung und des Programms seiner Partei, welche Ehling ausklammert.
Die Linkspartei hätte diese Wut aufgreifen, die Protestbewegungen mit der Klassenfrage verbinden und ein revolutionäres Programm vorantreiben können. Stattdessen begnügte sie sich mit parlamentarischem Betrieb, trug in der Regierung Sparpolitik mit und bot keine klassenkämpferische Perspektive. So wurde sie zum linken Feigenblatt des Establishments. In diesem Vakuum konnten die Rechten aufsteigen.
Wenn überhaupt von einer Blockade der Arbeiterklasse gesprochen werden kann, dann nur im Hinblick auf die bremsende Rolle ihrer Führung.
„Faschisierung“
Weil Ehling das Verhältnis zwischen Arbeiterklasse und Führung ignoriert, erscheint ihm die Ablehnung von Identitätspolitik und „Wokeness“ als Ausdruck eines „konservativen Zeitgeists“ oder gar einer „Faschisierung der Mitte“. Innerhalb seiner Logik wirkt das plausibel: Wenn sich die Massen nicht nach links wenden, dann müsse eine unsichtbare Macht sie nach rechts treiben. Damit mystifiziert Ehling gesellschaftliche Entwicklungen zu Naturphänomenen, die außerhalb unserer Kontrolle stehen würden.
Er übersieht, dass Identitätspolitik gerade in Zeiten von Sparpolitik vom Establishment gefördert wurde und viele sie deshalb mit Heuchelei und ihrer eigenen Verarmung verbinden. Wir erleben keine Faschisierung der Mitte, sondern eine Polarisierung der Gesellschaft. Diese äußert sich im Aufstieg von demagogischen Anti-Establishment-Kräften, deren Programm jedoch reaktionär ist. Die widersprüchliche Erscheinung dieser Kräfte lässt sich nicht mit starren Begriffen wie „links“ oder „rechts“ erklären, wie Ehling es versucht.
Repressionen
Zentral für Ehlings Analyse ist sein Staatsverständnis. Weil er sich nicht der marxistischen Methode bedient, übernimmt er das bürgerliche Bild vom Staat. Dieser erscheint bei ihm als neutraler Schiedsrichter zwischen den Klassen und als Garant abstrakter Ideale wie Freiheit und Gerechtigkeit.
Daher seine zentrale Sorge: Rechte wie Trump könnten durch zunehmende Repressionen die liberale Demokratie aushöhlen und letztlich abschaffen. Trump sei bereits ein Bonapartist, regiere angeblich per Dekret und ignoriere das Parlament.
Zwar ist es richtig, dass Trump massive Repressionen gegen Migranten, Palästina-Aktivisten und andere umsetzt. Doch Ehling setzt Repression willkürlich mit einer qualitativen Veränderung des Staatscharakters gleich. Der Staat ist kein neutrales Instrument, sondern ein Apparat zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung, notfalls auch mit autoritären Mitteln. Repression ist kein Ausnahmefall, sondern fester Bestandteil jeder bürgerlichen Demokratie.
Trumps Abschiebeoffensive ist zweifellos undemokratisch. Doch unter seinem demokratischen Vorgänger Biden wurden mehr Menschen abgeschoben als in Trumps erster Amtszeit. Auch unter Scholz kam es zu Polizeigewalt, Demonstrationsverboten und politisch motivierten Prozessen gegen Palästina-Aktivisten. Ehling müsste erklären, wodurch sich diese Repressionen qualitativ von denen der Rechten unterscheiden.
Angst vor der Arbeiterklasse
Trump führt keine starke Regierung, die mit nackter Gewalt regiert. Seine Macht beruht vor allem auf dem demagogischen Appell an die Arbeiter. Die Rechten versprechen eine Rückkehr zu den „guten alten Zeiten“ mit stabilen Arbeitsplätzen und hohem Lebensstandard.
Im Rahmen der kapitalistischen Krise wird sich zeigen, dass sie dieses Versprechen nicht einlösen können. Die Quadratur des Kreises – Steuergeschenke an Reiche bei gleichzeitiger Verbesserung des Lebensstandards der Massen – ist unmöglich. An dem Punkt, an dem diese Politik scheitert, wird die Stimmung, die sie an die Macht gebracht hat, in ihr Gegenteil umschlagen.
Erst kürzlich zeigte Trumps Kriegsbeteiligung im Israel-Iran-Konflikt, dass seine Anhängerschaft keineswegs blind folgt. Die Möglichkeit eines neuen Krieges drohte seine Unterstützerbasis durch die Mitte zu spalten.
Um eine Diktatur zu errichten, müssten die Herrschenden in einen offenen Kampf gegen die Organisationen der Arbeiterklasse treten. Weil die Arbeiterklasse aber über beträchtliche Kraftreserven verfügt, kann sich die herrschende Klasse solche Schritte nicht leisten. Die Mehrheit hat sich bisher noch nicht an Streiks und Bewegungen beteiligt – wegen der bremsenden Rolle der reformistischen Führungen, die jede konsequente Bewegung gegen die Regierung und den Kapitalismus fürchten und zurückhalten. Darauf ist die Kapitalistenklasse angewiesen, um ihre Herrschaft zu sichern.
Selbst wenn Trump diktatorische Ambitionen hätte, so wäre deren Umsetzung nicht seine individuelle Entscheidung. Sowas hängt vom Kräfteverhältnis zwischen den Klassen und vom Klassenkampf ab. Die Arbeiterklasse ist heute zu mächtig.
Das heißt nicht, dass bonapartistische Regime unmöglich sind. Wenn es der Arbeiterklasse nicht gelingt, die Macht zu erobern und der offene Klassenkampf in eine Sackgasse gerät, werden sich in der Zukunft die Bedingungen dafür herausbilden. Doch heute sind sie nicht gegeben. Wer jetzt das Gespenst von Bonapartismus oder Faschismus heraufbeschwört, ignoriert die reale Dynamik des Klassenkampfs und dessen unmittelbare Perspektiven.
Lösung der Linkspartei
Aus seiner falschen Analyse von Rechten, Staat und Klassenkampf zieht Ehling auch falsche Schlussfolgerungen. Seine Lösung besteht darin, durch Sozialreformen und die Verteidigung der liberalen Demokratie den Rechten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Der Forderungskatalog der Linkspartei ist nicht falsch: Mieten runter, Löhne hoch, Investitionen in Soziales. Auf parlamentarischen Wegen ist dies jedoch nicht erreichbar. Das Scheitern von „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ trotz Mehrheit beim Volksentscheid 2021 steht sinnbildlich für die Schranken der bürgerlichen Demokratie.
Dass der Staat grundlegende Veränderungen blockiert, zeigt auch die Tatsache, dass die Linkspartei in jeder Landesregierung, an der sie beteiligt war, Sparpolitik mitgetragen hat – entgegen ihren eigenen Versprechen.
Was Ehling als „Verteidigung der Demokratie“ bezeichnet, bedeutet konkret die Fortsetzung des bisherigen Kurses: Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien, um in Regierungsverantwortung zu kommen oder Staatskrisen zu verhindern. Praktisch heißt das: Sparpolitik zulassen. Das stärkt vorläufig die rechten Demagogen.
Demokratische Rechte und soziale Verbesserungen können im Kapitalismus nicht dauerhaft gesichert werden. Sie müssen durch Klassenkampf erkämpft und verteidigt werden. Dieser Kampf für Reformen muss stets mit dem Ziel verbunden werden, den Kapitalismus zu stürzen und den Sozialismus aufzubauen.
Eine Partei, die diesen Kampf führen will, muss Vertrauen in die Fähigkeit der Arbeiterklasse haben, die Gesellschaft zu verändern. Der Linkspartei fehlt das, weil sie sich nicht auf den Marxismus stützt.