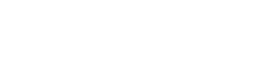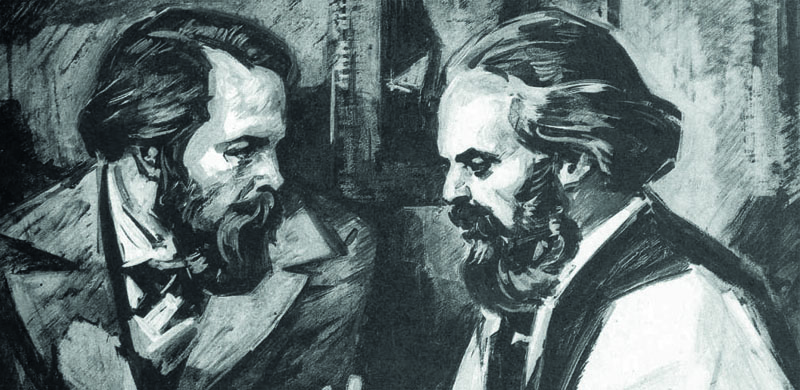Engels’ Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft zählt zu den zentralen Schriften des Marxismus. Jeder Kommunist sollte sie studiert haben. Sie enthält die Grundlagen marxistischer Theorie: Marxistische Philosophie, die dialektische Methode, den Historischen Materialismus, die zentralen ökonomischen Widersprüche des Kapitalismus. Gleichzeitig erklärt sie, warum der Sozialismus eben nicht nur ein frommer Wunsch ist, ein moralisches Ideal, sondern sich wissenschaftlich aus den Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft ergibt. Er ist also nicht nur realistisch, sondern historisch notwendig. Darin besteht der Unterschied zwischen dem Marxismus und jeder anderen „sozialistischen“ oder „linken“ politischen Strömung.
Engels stellt uns im ersten Kapitel die drei bekanntesten Vertreter des historischen utopischen Sozialismus (Owen, Fourier, Saint Simon) vor, zeigt uns ihre Stärken, aber auch ihre entscheidenden Schwächen. Der „utopische Sozialismus“ ist kein vergangenes Phänomen von ausschließlich historischem Interesse. Die reformistischen Führer der Linkspartei – um nur ein Beispiel zu nennen – sprechen immer wieder vom Sozialismus als „moralischem Kompass“, „Ideal“ oder „schöner Utopie“. Sie verschieben ihn damit in eine unbestimmte Zukunft oder gleich in das Reich der hehren Träume und Ideale. Im Hier und Jetzt bleibt uns, laut ihnen, dann nur die Realpolitik des kleineren Übels, der kleinen Reförmchen, der Kompromisse mit den Kapitalisten und letztlich die Mitverwaltung des Kapitalismus.
Ein utopisches Verständnis vom Sozialismus macht es einem unmöglich, tatsächlich erfolgreich für diesen zu kämpfen. Für Marxisten hingegen ist der Sozialismus kein moralischer Imperativ, kein hehres Ideal, sondern ergibt sich notwendig aus dem wissenschaftlichen Studium der Widersprüche des Kapitalismus, aus der inneren Logik der Entwicklung dieser Gesellschaft. (So wie die Geburt die logische Folge der inneren Widersprüche und Gesetze der Schwangerschaft ist und nicht einfach geschieht, weil dies womöglich moralisch wünschenswert wäre.) Um diese wissenschaftliche Analyse machen zu können, braucht es die marxistische Theorie: Sie ist in anderen Worten die Wissenschaft des Sozialismus.
Im zweiten Kapitel erklärt uns Engels das philosophische Fundament dieser wissenschaftlichen Methode des Marxismus: die Dialektik und den Materialismus. Im dritten Kapitel wendet er diese Grundlage konkret auf die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft an. So zeigt er uns zum einen die marxistische Geschichtsauffassung, den Historischen Materialismus, zum anderen die Grundzüge der marxistischen ökonomischen Analyse des Kapitalismus.
Diese 1880 erschienene Broschüre ist eine Zusammenstellung von drei Kapiteln aus Engels‘ Buch Anti-Dühring. Es wurde nicht nur zur Bekämpfung der „neuen“ sozialistischen Theorien Eugen Dührings verfasst, sondern liefert „eine enzyklopädische Übersicht über unsere Auffassung der philosophischen, naturwissenschaftlichen und historischen Probleme“ in Engels‘ eigenen Worten.
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft fasst einige der wichtigsten Ideen aus Engels‘ Buch in einer prägnanten und sehr zugänglichen Broschüre zusammen. Sie verdient durchaus im Laufe der Zeit mehrfach gelesen zu werden.
Darüber hinaus ist Engels‘ Einleitung zur englischen Ausgabe (1892) sehr bereichernd. Sie ist einerseits eine wertvolle Erklärung und Verteidigung der materialistischen Philosophie. Und andererseits auch eine Lektion im Historischen Materialismus. Die Entwicklung der Philosophie und der Ideen wird in den Kontext der zugrunde liegenden Revolution in der Entwicklung der Produktivkräfte und des Klassenkampfes gestellt.
I. Kapitel: Der utopische Sozialismus
Das erste Kapitel von Engels‘ Broschüre ist den großen utopischen Sozialisten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts gewidmet, den Vorvätern des wissenschaftlichen Sozialismus von Marx und Engels: Charles Fourier, Henri Saint-Simon und Robert Owen.
Die bürgerlichen Revolutionen, wie z.B. die französische von 1789-95, waren mit dem Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit angetreten. Nach ihrem Sieg zeigte sich, dass diese Versprechen nur für die Bourgeoisie galten – die arbeitenden Massen blieben weiter unterdrückt, obwohl sie in den Revolutionen am tapfersten gegen König und Adel gekämpft hatten. Das junge Proletariat entwickelte sich in den Jahrzehnten danach immer mehr, wuchs und brachte erste Arbeiterbewegungen hervor.
In dieser Zeit – zwischen bürgerlicher Revolution und den ersten großen Arbeiterbewegungen – entstanden auch die klassischen Theorien des utopischen Sozialismus. Sie gingen aber von der idealistischen Philosophie der Aufklärung aus: Sie leiteten den Sozialismus als moralisches Gebot aus der Einsicht in die absolute Vernunft ab. Die bürgerlichen Philosophen der Aufklärung hatten Feudalismus und Monarchie dafür kritisiert, dass diese Herrschaftsform nicht „vernünftig“ sei, d.h. einer allgemeinen, universellen, ewig gültigen menschlichen Vernunft und Moral widersprechen würde. Die utopischen Sozialisten begründeten nun, Anfang des 19. Jahrhunderts, den Sozialismus auf die gleiche Weise.
Sie entwarfen am Reißbrett Modelle für perfekte Utopien, die der „Vernunft“ am besten entsprechen würden. Sie versuchten diese einzuführen, indem sie an die Vernunft der herrschenden Bourgeoisie appellierten und versuchten, sie durch vernünftige Argumente zu überzeugen. In ihrer Vorstellung kam der Sozialismus nicht durch die eigenständige Aktivität, d.h. den Kampf, der Arbeiterklasse, sondern durch die vernünftige Einsicht und moralische Integrität der Kapitalisten zustande. Dieser Ansatz verurteilte sie zum Scheitern. Noch heute bedienen sich Reformisten und Linksliberale derselben Methode.
Trotzdem war der utopische Sozialismus ein Fortschritt und ein Wegbereiter des Marxismus, denn die utopischen Sozialisten hatten bereits einige geniale Analysen und Einsichten in die Funktionsweise der Gesellschaft. Engels hebt diese positiven Beiträge trotz der Kritik hervor. Da sind z.B. die Versuche des Unternehmers und utopischen Sozialisten Robert Owen, kommunistische Arbeiterkolonien zu gründen, in denen die Arbeiter zu menschenwürdigen Bedingungen leben und arbeiten konnten. Diese Experimente zeigten zum einen, dass die Arbeiter sehr wohl die Fabriken selbst verwalten können. Aber sie zeigten eben auch die engen Limitationen des Versuchs, durch Kommunen und Kooperativen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft „sozialistische Inseln“ zu schaffen. Diese Lehre brachte Robert Owen dazu, vom großzügigen Wohltäter zum Kommunisten und Unterstützer der Arbeiterbewegung zu werden. Er hörte auf, an die Kapitalisten zu appellieren und unterstützte die junge englische Arbeiterbewegung in ihrem Kampf, etwa in der Zeit des Chartismus (die erste richtige Arbeiterbewegung auf englischem Boden). Marx und Engels gingen weiter in diese Richtung: Nicht die Einsicht der Herrschenden, sondern der selbstständige Kampf der Arbeiterklasse wird den Sozialismus erringen.
Diesen entscheidenden Unterschied zwischen Utopischem Sozialismus und Marxismus, fassten Marx und Engels in der Deutschen Ideologie so zusammen: „Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung.“
Diskussionsfragen:
In welchem Sinne wurde die Welt für die Philosophen des 18. Jahrhunderts (Aufklärung) „auf den Kopf gestellt“?
Was meint Engels, wenn er schreibt: „So wenig wie alle ihre Vorgänger konnten die großen Denker des 18. Jahrhunderts hinaus über die Schranken, die ihnen ihre eigne Epoche gesetzt hatte“?
Warum waren die durch den „Sieg der Vernunft“ geschaffenen Institutionen solch „bitter enttäuschende Zerrbilder“?
Was eint die „drei großen Utopisten“?
Wie macht „die große Industrie“ eine Revolution notwendig?
Warum waren die neuen Gesellschaftssysteme der Begründer des Sozialismus „von vornherein zur Utopie verdammt“?
In welchem Sinne ist die Politik „die Wissenschaft der Produktion“?
In welchem Sinne war Fouriers Geschichtsauffassung dialektisch?
Welche Ähnlichkeiten können wir zwischen Owens Philosophie und der von Marx erkennen?
Was waren die Grenzen von Owens Kommunismus?
II. Kapitel: Die Dialektik
Das zweite Kapitel erklärt die unterschiedlichen philosophischen Herangehensweisen, die hinter dem utopischen Sozialismus einerseits und dem wissenschaftlichen Sozialismus (Marxismus) andererseits stehen: Metaphysik vs. Dialektik und Idealismus vs. Materialismus.
Der Begriff „Metaphysik“ wurde in der Geschichte der Philosophie sehr verschieden benutzt; bei Engels heißt er folgendes: Die Metaphysik analysiert die Dinge in der Welt nicht in ihrer Beziehung zu anderen Dingen, also ihrem Zusammenhang, sondern als isolierte Einzelteile; „nicht in ihrer Bewegung, sondern in ihrem Stillstand“. Sie benutzt die formale Logik, d.h. sie denkt nur in fixen Kategorien: a=a, a=/=b. In einem gewissen Rahmen ist diese Methode nützlich, aber sie gerät schnell an ihre Grenzen. Engels schreibt: „Für den Metaphysiker sind die Dinge und ihre Gedankenabbilder, die Begriffe, vereinzelte, eins nach dem andern und ohne das andre zu betrachtende, feste, starre, ein für allemal gegebne Gegenstände der Untersuchung. Er denkt in lauter unvermittelten Gegensätzen; seine Rede ist ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel.“ Dadurch ist die Metaphysik unfähig, Widersprüche zu verstehen.
Im Gegensatz dazu steht die Dialektik: Sie begreift die Dinge in ihrem Zusammenhang und in ihrer Bewegung, d.h. auch in ihrem Widerspruch. Denn wenn wir uns die Welt anschauen, so besteht sie nicht aus starren, isolierten Dingen, sondern aus unendlichen Prozessen, Bewegungen und Zusammenhängen der verschiedenen Dinge zueinander. Die Dialektik ist sozusagen die Lehre oder die Wissenschaft der Bewegung, Entwicklung und Veränderung. D.h. sie versucht präzise zu erklären, wie Bewegung und Veränderung vonstattengehen. Schon die alten griechischen Philosophen vertraten dialektische Ideen. Aber erst der deutsche Philosoph G. W. F. Hegel systematisierte die Dialektik in der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert.
Die utopischen Sozialisten sind Metaphsyiker, während die Marxisten Dialektiker sind. Die utopischen Sozialisten haben ihre aus einer absoluten, universellen Moral oder Vernunft abgeleiteten Kategorien: Kapitalismus = schlecht, Sozialismus = gut etc. Aber sie können die Entwicklung vom einen zum anderen nicht begreifen, denn sie haben keine philosophische Methode, mit der man die Dinge in ihrer Bewegung verstehen kann. Dadurch wird der Sozialismus bei ihnen in Wahrheit zu einem unerreichbaren Fernziel und im Hier und Jetzt bleibt nur kleines Herumdoktorn am System oder leere Appelle. Dasselbe gilt für die heutigen Reformisten, Linksliberale, Anarchisten und alle, deren politisches Hauptargument moralische Empörung ist.
Der Idealismus sieht, im Gegensatz zum Materialismus, die Ideen als das Primäre, nicht die Materie. Für die Idealisten bestimmen die Ideen, wie die Realität ist; sie existierten vor der Materie und setzen sich gegen sie durch. Die utopischen Sozialisten sind Idealisten, denn der Ausgangs- und Endpunkt ihrer Politik ist eben die absolute, universelle, ewige Vernunft oder Moral – eben Ideen. Sie gehen zudem davon aus, man könne die Gesellschaft ändern, wenn man nur die herrschenden Ideen ändert bzw. wenn man die herrschenden Kapitalisten davon überzeugt, dass andere Ideen vernünftiger sind. Auch das haben sie mit den heutigen Reformisten gemeinsam.
Der Materialismus geht hingegen davon aus, dass die Materie das Primäre ist und die Ideen vor allem Widerspiegelung der materiellen Welt im menschlichen Gehirn sind. Die „Vernunft“ der Aufklärung ist keine universelle, ewig gültige Vernunft, sondern sie ist das Produkt einer bestimmten historischen Epoche und einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse, deren Interesse sie zum Ausdruck bringt: nämlich der jungen Bourgeoisie im Kampf gegen den Feudalismus.
Sowohl Metaphysik als auch Dialektik können materialistisch oder idealistisch sein. Metaphysisch war zum Beispiel der englische und französische Materialismus des 18. Jahrhunderts – er war ein mechanischer Materialismus, der die Welt wie ein riesiges Uhrwerk verstand. Hegels Dialektik war eine idealistische Dialektik, denn sie analysierte nicht die Bewegung und Entwicklung der realen Welt, sondern die der menschlichen Ideen im Laufe der Geschichte. Marx und Engels machten die Dialektik materialistisch. Bei ihnen geht es darum, die Bewegung und Entwicklung der realen, materiellen Welt zu begreifen.
Eben weil der Marxismus das kann, kann er aufzeigen, wie man vom Hier und Jetzt zum Sozialismus kommt, statt nur wie die utopischen Sozialisten zu erklären, warum dieser wünschenswert wäre. Engels fasst das so zusammen:
„Hiernach erschien jetzt der Sozialismus nicht mehr als zufällige Entdeckung dieses oder jenes genialen Kopfs, sondern als das notwendige Erzeugnis des Kampfes zweier geschichtlich entstandner Klassen, des Proletariats und der Bourgeoisie. […] Der bisherige [utopische] Sozialismus kritisierte zwar die bestehende kapitalistische Produktionsweise und ihre Folgen, konnte sie aber nicht erklären, also auch nicht mit ihr fertig werden; er konnte sie nur einfach als schlecht verwerfen. Je heftiger er gegen die von ihr unzertrennliche Ausbeutung der Arbeiterklasse eiferte, desto weniger war er imstand, deutlich anzugeben, worin diese Ausbeutung bestehe und wie sie entstehe. […] Diese beiden großen Entdeckungen: die materialistische Geschichtsauffassung und die Enthüllung des Geheimnisses der kapitalistischen Produktion vermittelst des Mehrwerts verdanken wir Marx. Mit ihnen wurde der Sozialismus eine Wissenschaft […].“
Diskussionsfragen:
Was ist Dialektik?
Was ist der Unterschied zwischen der Dialektik der Antike und der Dialektik von Hegel?
Was ist das Problem mit der Dialektik von Hegel?
Was meinte Engels, als er sagte, dass der moderne Materialismus „keine über den andern Wissenschaften stehende Philosophie mehr [braucht]“?
Warum ist die Philosophie Hegels wichtig für den Sozialismus?
III. Kapitel: Der Historische Materialismus
Im dritten Kapitel wendet Engels die philosophische Methode, die er in Kapitel zwei erklärt hat (den Dialektischen Materialismus), auf die Entwicklung der Gesellschaft an, um auf wissenschaftliche Weise den Sozialismus zu begründen.
Zu Beginn gibt Engels eine kurze und bündige Erklärung des Historischen Materialismus, also der marxistischen Geschichtsauffassung. Er erklärt, dass die Gründe für gesellschaftliche Veränderungen wie z.B. die Französische Revolution, nicht in den Ideen einer Zeit, sondern in der materiellen, d.h. ökonomischen Grundlage liegen: „Hiernach sind die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Umwälzungen zu suchen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern in Veränderungen der Produktions- und Austauschweise; sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern in der Ökonomie der betreffenden Epoche.“
Schon mit dieser Herangehensweise grenzt sich Engels grundlegend vom utopischen Sozialismus ab, denn: „Damit ist zugleich gesagt, daß die Mittel zur Beseitigung der entdeckten Mißstände ebenfalls in den veränderten Produktionsverhältnissen selbst – mehr oder minder entwickelt – vorhanden sein müssen. Diese Mittel sind nicht etwa aus dem Kopfe zu erfinden, sondern vermittelst des Kopfes in den vorliegenden materiellen Tatsachen der Produktion zu entdecken.“
Der Ausgangspunkt für den wissenschaftlichen Sozialismus ist also eine gründliche, wissenschaftliche Analyse der realen, konkreten Entwicklung der Gesellschaft. Und die nimmt Engels hier vor: Angefangen beim Mittelalter, erklärt er, wie die Warenproduktion sich bahnbricht, der Kapitalismus zur bestimmenden Produktions- und Austausch weise wird. Er erklärt den zentralen Widerspruch des Kapitalismus (der zwischen kollektiver Produktion der Waren in der Fabrik und privater Aneignung der Profite) und welche Formen er annimmt. Eine davon ist die Überproduktionskrise, die beweist, dass der Kapitalismus unfähig ist, die Gesellschaft weiter nachvorn zu bringen. In dieser meisterhaften dialektischen Analyse erfahren wir, wie der Kapitalismus aufstieg, warum er so erfolgreich dabei war, die Produktivkräfte weiterzuentwickeln, warum er jetzt an seine Grenzen gerät und vor allem: Warum der Sozialismus sich notwendig und logisch aus den Widersprüchen des Kapitalismus ergibt.
Doch trotzdem ist der Sozialismus kein mechanischer Automatismus. Er muss aktiv und bewusst erkämpft werden! Der Kapitalismus im krisenhaften Niedergang bringt auch den handelnden Akteur hervor, der ihn abschaffen und den Sozialismus erkämpfen wird: Das Proletariat (die moderne Arbeiterklasse), die als einzige gesellschaftliche Kraft das Interesse und die Macht hat, den Sozialismus durchzusetzen. Engels erklärt, wie die Schaffung des Sozialismus durch das Proletariat zur Abschaffung der Klassen überhaupt und damit zum Kommunismus führt.
Abschließend erklärt Engels die Aufgabe des Marxismus so: „Diese weltbefreiende Tat durchzuführen ist der geschichtliche Beruf des modernen Proletariats. Ihre geschichtlichen Bedingungen, und damit ihre Natur selbst, zu ergründen und so der zur Aktion berufnen, heute unterdrückten Klasse die Bedingungen und die Natur ihrer eignen Aktion zum Bewußtsein zu bringen ist die Aufgabe des theoretischen Ausdrucks der proletarischen Bewegung, des wissenschaftlichen Sozialismus.“
Diskussionsfragen:
Engels schreibt: „Hiernach sind die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Umwälzungen zu suchen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern in, Veränderungen der Produktions- und Austauschweise.“ Wie könnte man diese Beobachtung auf eine große soziale Bewegung unserer Zeit anwenden, wie etwa die politische Polarisierung im Westen?
Engels verweist auf die Entstehung der geplanten Produktion mit dem Fabriksystem. Was genau hat er damit gemeint?
Engels betont sehr stark die Produktion von „Waren“. Was ist eine Ware?
Engels erwähnt eine Reihe von Beispielen für einen „fehlerhaften Kreislauf“ in der Entwicklung des Kapitalismus. Welche waren das?
Was versteht Engels unter der „Rebellion der Produktivkräfte“ und was sind die „Produktivkräfte“?
Welche zentralen Widersprüche des Kapitalismus arbeitet Engels heraus?
Engels schreibt: „Diese Lösung kann nur darin liegen, daß die gesellschaftliche Natur der modernen Produktivkräfte tatsächlich anerkannt, daß also die Produktions-, Aneignungs- und Austauschweise in Einklang gesetzt wird mit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktionsmittel.“ Worin besteht die „gesellschaftliche Natur“ der modernen Produktivkräfte? Warum stehen sie in Widerspruch zur kapitalistischen Aneignungsweise? Welche Versuche macht der Kapitalismus, die Aneignungsweise der „gesellschaftliche Natur“ der Produktion anzupassen?
Engels schreibt: „Die gesellschaftlich wirksamen Kräfte wirken ganz wie die Naturkräfte: blindlings, gewaltsam, zerstörend, solange wir sie nicht erkennen und nicht mit ihnen rechnen.“ Was ist der fundamentale Grund dafür, dass die sozialen Kräfte von der Menschheit nicht verstanden oder kontrolliert werden? Was muss sich ändern, damit sie verstanden und kontrolliert werden können?
Welche unterschiedlichen Beziehungen zwischen dem Staat und der Gesellschaft erwähnt Engels, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind? Was könnte es bedeuten, dass der Staat „wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt“ und warum würde er dann verschwinden?
[1] Die Philister waren ursprünglich ein Volk, welches ab dem 12. Jahrhundert die Küste des historischen Palästinas bewohnte. Der Begriff Philister wird als Abwertung für ein kleinbürgerliches bzw. engstirniges Weltbild mit vereinfachten Moralvorstellungen verwendet.