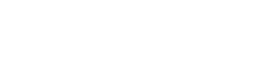Das Übergangsprogramm von Leo Trotzki (eigentlich „Der Todeskampf des Kapitalismus und die Aufgaben der Vierten Internationale“) gehört zu den Klassikern marxistischer Theorie und sollte von jedem Kommunisten studiert werden.
Trotzki schrieb diesen Text 1938 als Gründungsdokument der Vierten Internationale. Aber die Übergangsmethode, die er darin entwickelt, ist keineswegs seine Erfindung, sondern gehörte schon immer zum Marxismus.
Der Kern der Übergangsmethode ist, eine Brücke zu schlagen zwischen dem fertigen Programm für die sozialistische Revolution einerseits und dem konkreten, unfertigen, sich entwickelnden Bewusstsein der Arbeiterklasse andererseits.
Der Charakter der Epoche
Trotzki erklärte einmal, dass ein Programm mehr ist als eine bloße Liste an Forderungen: Es ist das gemeinsame Verständnis der Situation und der Aufgaben, die daraus fließen und stellt damit den Zusammenhalt der revolutionären Partei dar. Deswegen beginnt Trotzkis Übergangsprogramm mit einer prägnanten Charakterisierung der Epoche, in der es geschrieben wurde.
Der Kapitalismus befand sich in den 1930ern in einer organischen Krise. D.h. es handelte sich nicht um eine vorübergehende, konjunkturelle Krise, sondern um eine chronisch gewordene Krise des ganzen Systems, bei der die erwarteten Erholungen ausblieben.
Der Kapitalismus als Produktionsweise war völlig unfähig geworden, die Produktivkräfte und damit die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Fabrikschließungen, fallender Lebensstandard, Arbeitslosigkeit und Kriegsgefahr machten sich breit. Auf Grundlage des Kapitalismus konnte keines dieser Probleme gelöst werden. Dafür brauchte es einen Bruch mit dem Privateigentum an den Produktionsmitteln und die sozialistische Planung der Wirtschaft.
Doch dieser Weg kam für die herrschende Klasse und ihre Politiker natürlich nicht in Frage. Sie unternahmen verzweifelt abenteuerliche politische Maßnahmen wie den „New Deal“ von US-Präsident Roosevelt. Das war ein Versuch, die Probleme des Kapitalismus durch eine massive Ausweitung der Verschuldung zu lösen, was jedoch nicht funktionierte. In Europa übertrug das Kapital die politische Macht zunehmend faschistischen Diktaturen. All das kennzeichnete die Unfähigkeit der Bourgeoisie ihre Herrschaft auf die gewohnte stabile Weise fortzuführen.
Notwendigkeit der Revolution
Trotzki erklärte, dass das ein Zeichen dafür war, dass die Bedingungen für den Sozialismus längst reif waren. Sie waren sogar überreif und begannen schon zu „verfaulen“, wie er sagte.
Da die Bourgeoisie unfähig war die Gesellschaft aus dieser Sackgasse zu führen, hing alles von der Arbeiterklasse ab. Ihre objektive Aufgabe war die Macht zu übernehmen, den Kapitalismus zu stürzen und den Sozialismus einzuführen.
Die Arbeiterklasse hatte auf der ganzen Welt gezeigt, dass sie bereit war zu kämpfen. Angefangen mit der internationalen revolutionären Welle ab 1917. Später mit der chinesischen Revolution 1925-27, der spanischen 1931-39, der Massenbewegung in Frankreich um 1936 und dem Erblühen einer sehr kämpferischen Gewerkschaftsbewegung in den USA, die 1935 zur Gründung der Gewerkschaftsföderation CIO führte.
Aber die Führer der sozialdemokratischen und stalinistischen Massenorganisationen der Arbeiterklasse (II. und III. Internationale) bremsten diese Bewegung der Arbeiter voll aus. Beide hatten auf ihre Weise ein Bündnis mit der Bourgeoisie geschlossen und führten revolutionäre Bewegungen in Niederlagen. Trotzki erklärte daher: „Die geschichtliche Krise der Menschheit läuft auf eine Krise der revolutionären Führung hinaus.“ Deswegen gründete er 1938 die IV. Internationale.
Die Aufgabe der Vierten Internationale bestand darin, wie Trotzki erklärte, die Lücke zwischen der Reife der objektiven Situation einerseits und der Unreife des Bewusstseins der Arbeiterklasse und besonders seiner Führung zu schließen, und zwar mit Hilfe des Übergangsprogramms.
Reformistisches Programm
Trotzki erklärte, dass die alte Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg ihr Programm in zwei voneinander getrennte Teile aufspaltete: Das Minimalprogramm mit konkreten, unmittelbaren Verbesserungen im Kapitalismus (z.B. Lohnerhöhungen) und dem Maximalprogramm, der Einführung des Sozialismus. Zwischen beiden Teilen des Programms bestand keine Brücke.
Einerseits der kurzsichtige Klassenkampf um Reformen im Hier und Jetzt, andererseits Revolution und Sozialismus im fernen Himmelreich der Ideen. So verschob der Reformismus die sozialistische Revolution auf den Sankt-Nimmerleinstag.
Die reformistischen Führer zeigten nicht auf, dass der Kampf für alltägliche Verbesserungen für die Arbeiter zwangsläufig an die Grenzen des Kapitalismus stößt und deshalb die sozialistische Revolution die notwendige und logische Fortsetzung der vereinzelten Kämpfe der Arbeiterklasse ist. Indem sie beides voneinander trennten, schufen sie den Ausgangspunkt für die reformistische Degeneration der sozialdemokratischen Parteien und für ihren Verrat in der revolutionären Welle, die den Ersten Weltkrieg beendete.
Die Grundlage für das Entstehen dieser Idee eines ewigen sozialen Fortschritts innerhalb des Kapitalismus bildete der historische Wirtschaftsaufschwung in Deutschland von 1871 bis 1900. In dieser Zeit konnte die Sozialdemokratie einige Forderungen des Minimalprogramms durchsetzen. Denn die Profite sprudelten und so konnten die Kapitalisten den Arbeitern ein paar Brotkrumen abgeben.
Aber in der neuen Epoche der organischen Krise des Kapitalismus, die auf den Ersten Weltkrieg folgte, war das nicht mehr in diesem Maße möglich. Die Profite der Kapitalisten sanken und die Konkurrenz der imperialistischen Staaten auf der Weltbühne spitze sich immer weiter zu. Die Grenzen der kapitalistischen Entwicklung waren erreicht, die konkret im Privateigentum an den Produktionsmitteln und den Grenzen des Nationalstaats bestehen. Der Kampf des Proletariats um die Erhaltung der bisherigen Lebensbedingungen wurde so zum offenen Kampf gegen den Kapitalismus.
Illusionen in den Kapitalismus
Übergangsforderungen tragen genau dieser Einsicht Rechnung. Sie haben nicht den Zweck, spezielle kommunistische Forderungen der Arbeiterklasse überzustülpen. Gerade in der Krise stellen Arbeiter sehr intuitiv Forderungen entlang ihrer konkreten Probleme auf. Das kann beispielsweise ein zu geringer Lohn, eine drohende Werksschließung oder auf politischer Ebene die Opposition gegen die Einschränkung demokratischer Rechte sein.
Gleichzeitig wirken in der Arbeiterklasse verschiedene Illusionen in die bürgerliche Demokratie, die Nation, den Kapitalismus oder die reformistischen Arbeiterführer. All diese Illusionen halten die Arbeiterklasse schlussendlich passiv und gespalten. Sie vertrauen auf ihre Vertreter oder die herrschenden Institutionen und lassen sich gegen ihre Klassenbrüder aufhetzen. So ist die Durchsetzung jeder ihrer Forderungen zum Scheitern verurteilt.
Deshalb müssen Übergangsforderungen auf die Auflösung dieser Illusionen abzielen. Hierfür müssen sie nicht besonders revolutionär klingen. Die Bolschewiki nutzen beispielsweise die Losung „Brot, Land, Frieden“, um die Arbeiter 1917 in Russland zu überzeugen. Eine Übergangsforderung für sich stehend kann oft genauso gut eine Minimalforderung sein. Die entscheidende Frage ist, mit welchen weiterführenden Erklärungen und Forderungen diese verbunden wird.
Reformisten kennen vor allem zwei Vorgehensweisen. Auch sie gehen von unmittelbaren populären Forderungen aus, kommen dann aber immer wieder zu einem von zwei Schlüssen. Entweder sei die Forderung schlicht unrealistisch und könne nicht umgesetzt werden oder die Arbeiter sollten sich nur ruhig auf ihre Vertreter verlassen, die für sie ihre Forderungen im Parlament oder der Verhandlung mit den Kapitalisten umsetzen würden.
Übergangsmethode
Kommunisten hingegen betonen, dass die Arbeiter selbst eingreifen müssen und sich bei der Durchsetzung ihrer Forderungen nur auf die eigene Kraft verlassen können. Das wiederum macht den Wesenskern einer Übergangsforderung aus, nicht dass sie einen besonders revolutionär wirkenden Inhalt besitzt, sondern den Arbeitern praktisch und ideologisch hilft, selbst revolutionäre Schlussfolgerungen zu ziehen.
Das wiederum führt die Arbeiterklasse selbst zum Inhalt der sozialistischen Revolution, indem sie sich Einsicht in die Geschäftsbücher der Kapitalisten verschaffen, Räte und Komitees zur Kontrolle der Wirtschaft und Politik gründen, sich zur Selbstverteidigung bewaffnen und schließlich die Macht übernehmen. All das stets getrieben von dem Willen, in konkreten Fragen Verbesserungen zu erreichen und der Erkenntnis diese nur selbst durchsetzen zu können.
Welche Forderung aufgestellt oder aufgegriffen werden sollte, hängt immer von der konkreten Situation ab. Ein und dieselbe Forderung kann an einem Zeitpunkt richtig und fortschrittlich sein, zu einem anderen Zeitpunkt falsch und reaktionär. Eine Forderung ist dann richtig, wenn sie hilft, das Bewusstsein der Arbeiter auf die nächste notwendige Stufe zu heben.
Hierfür ein Beispiel: In den 1930ern begann sich die Gefahr eines neuen Krieges abzuzeichnen. Die Regierungen rüsteten auf. Die Bourgeoisie in Großbritannien, Frankreich und den USA begründete das mit der Gefahr einer Invasion Nazi-Deutschlands. So sollte die Arbeiterklasse im kommenden Krieg auf diese Seite ihrer nationalen Bourgeoisie gezogen werden.
Trotzki erklärte, dass die „Verteidigung des Vaterlands“ für die Arbeiter und Kleinbauern etwas völlig anderes heißt als für die Kapitalisten. Die Kapitalisten verstehen darunter die Verteidigung ihrer Profite in fernen Ländern, die Arbeiter und Kleinbauern verstehen darunter die Verteidigung ihrer Familie und ihres Zuhauses.
Ein Sieg der Nazis hätte die Zerschlagung der britischen oder amerikanischen Arbeiterbewegung bedeutet. Der Wille, aus proletarischen Klasseninteressen gegen den Faschismus zu kämpfen, ist das progressive Element in diesem Bewusstsein. Die Idee, man müsse dazu zusammen mit den Kapitalisten das Vaterland verteidigen, das reaktionäre.
In dieser Situation zu den Arbeitern zu sagen „Der Hauptfeind steht im eigenen Land! Die Niederlage der eigenen Bourgeoisie ist das geringere Übel! Brecht mit eurer Regierung und sabotiert die Kriegsanstrengungen! Stürzt sie lieber und übernehmt die Macht!“ wäre falsch, denn die Arbeiter würden das nicht verstehen. Sollen sie sich von Hitlers Horden überrennen lassen?
Unabhängigkeit vom Kapital
Nach dem Ausbruch des Krieges stellte Trotzki die Frage deshalb anders: Auch wir sehen, dass die Arbeiter sich gegen Nazi-Deutschland verteidigen müssen. Aber können wir wirklich den Kapitalisten und der bürgerlichen Regierung der USA und Großbritanniens vertrauen, diesen Abwehrkampf im Interesse der Arbeiter erfolgreich und konsequent zu führen?
Nein! Deswegen fordern wir die militärische Ausbildung und Bewaffnung der Arbeiter und Bauern unter unmittelbarer Kontrolle der Arbeiter- und Bauernräte! Schaffung von Militärschulen für die Ausbildung von Arbeitern zu Offizieren unter der Kontrolle der Arbeiterorganisationen. Sturz der bürgerlichen Regierung, da eine Arbeiterregierung diesen Krieg besser führen kann.
Auch so kommen die Arbeiter zum Schluss: Wir müssen die Macht selber übernehmen und unsere imperialistische Regierung stürzen, statt für ihre imperialistischen Interessen zu kämpfen. Und zwar weil die Forderungen von dem unmittelbaren Bewusstsein ausgingen, den Faschismus zu bekämpfen.
Schule der Revolution
Indem die Arbeiter in der Praxis für Übergangsforderungen kämpfen, machen sie Erfahrungen, aus denen sie gewisse Lehren ziehen. So hatten nach der Februarrevolution 1917 in Russland die reformistischen Menschewiki und Sozialrevolutionäre die Mehrheit in den Arbeiterräten (Sowjets). Die reformistische Mehrheit in den Sowjets stützte die kapitalistische Übergangsregierung. Die Massen vertrauten ihnen noch, denn sie hatten noch nicht den Unterschied zwischen reformistischen „Sozialisten“ und revolutionären Sozialisten begriffen.
Die Bolschewiki hätten einfach sagen können: „Arbeiter traut nicht diesen Verrätern!“ Aber das hätte die Massen nicht überzeugt. Denn sie mussten erst in der Praxis für sich selbst lernen, dass die Reformisten Verräter sind. Deswegen sagten die Bolschewiki: „Menschewiki und Sozialrevolutionäre, ihr habt die Mehrheit in den Sowjets und ihr nennt euch Sozialisten. Wir fordern euch auf: Brecht mit den Kapitalisten und ihrer Regierung und übernehmt die Macht im Namen der Arbeiterklasse! In diesem Falle beschränken wir uns auf eine friedliche Diskussion in den Sowjets.“
Diese Forderung fand Unterstützung bei den breiten Massen, die zwar die Kapitalisten hassten, aber noch Illusionen in die Menschewiki und Sozialrevolutionäre hatten und sie begannen, diese Forderung aufzugreifen. In den nächsten Monaten machten die russischen Massen in der Praxis die Erfahrung, dass die Reformisten unter keinen Umständen bereit waren, mit den Kapitalisten zu brechen. Und ab September begannen die Bolschewiki in immer mehr Sowjets Mehrheiten zu gewinnen. So wurde der Weg für die Oktoberrevolution bereitet.
Eine Ausnahmesituation
Durch einige besondere historische Umstände kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem langen wirtschaftlichen Aufschwung des Kapitalismus, etwa von Anfang der 1950er bis Anfang der 1970er Jahre. In dieser Zeit konnten wieder gewisse Reformen erkämpft werden, denn die Profite sprudelten. Doch die inneren Widersprüche des Kapitalismus brachten ab Mitte der 1970er Jahre wieder eine tiefe Krise hervor.
Nur der Fall der Sowjetunion und die Öffnung Chinas verschafften dem Kapitalismus eine gewisse Atempause, da dem weltweiten Kapitalismus nun neue Absatzmärkte und Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung standen. Doch diese Atempause endete 2008 mit der Weltwirtschaftskrise. Seitdem ist die organische Krise des Kapitalismus auf der ganzen Welt wieder offen zu Tage getreten. Aus ihr gibt es im Kapitalismus ohne weiteres keinen Ausweg.
Sie ist wieder eine Krise der gesamten kapitalistischen Gesellschaft. Ab den 1980er Jahren gab es statt sozialer Reformen nur Kürzungs- und Austeritätspolitik. Die reformistischen Massenorganisationen können kaum noch Reformen erkämpfen und setzen im Gegenteil Angriffe auf den Lebensstandard der Massen mit um. Wir sehen heute einen Reformismus ohne Reformen.
Eine fundamentale Krise
Der Kapitalismus kann auch heute keines der großen gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit lösen: Klimawandel, Krieg, Deindustrialisierung, Armut, Wohnungsproblem, Gleichberechtigung der Geschlechter etc. Die Lösung all dieser Probleme scheitert am grundlegenden Widerspruch des Kapitalismus: am Profitstreben. Wir haben genügend Industrie und Technologie, um all diese Probleme zu lösen. Nur das Privateigentum an Produktionsmitteln und die Nationalstaaten hindern uns daran, sie dafür einzusetzen. Der Klimawandel ist ein gutes Beispiel dafür.
Auch heute führt jeder Versuch der Massen, gegen diese ihr Leben unmittelbar betreffenden Probleme zu kämpfen, direkt an die Grenze des kapitalistischen Systems und zur Notwendigkeit der Machtübernahme durch die Arbeiterklasse. Wie soll beispielsweise der Klimawandel anders gestoppt werden als durch eine internationale Planwirtschaft?
Die Arbeiterklasse beginnt sich bereits zu radikalisieren und will gegen diese unmittelbaren Probleme kämpfen. Das Vertrauen in bürgerliche Institutionen wie Parteien, Parlamente, Mainstream-Medien oder die Kirchen sinkt.
Die Welle der Kürzungspolitik nach der Krise von 2008 brachte gewaltige Massenbewegungen hervor: In Griechenland allein fanden 10 Generalstreiks statt. Millionen Arbeiter unterstützten linksreformistische Führer und Parteien, die eine Zeit lang eine kämpferische Rhetorik an den Tag legten, und gingen für sie auf die Straße.
Auch in den imperialistisch unterdrückten Ländern standen die Massen auf und bewiesen ihre Kampfbereitschaft, z.B. im arabischen Frühling ab 2011. Dort stürzten die ägyptischen Massen mehrere Präsidenten hintereinander.
Allein im Jahr 2019 kam zu potentiell revolutionären Massenbewegungen in Hongkong, dem Libanon, dem Sudan, Chile, Ecuador, Kolumbien und in Frankreich marschierten die Gelbwesten.
Sackgasse Reformismus
Doch all diese Bewegungen wurden letztlich von ihrer politischen Führung in Niederlagen geführt. Die Bewegungen in den unterdrückten Ländern wurden oft von Liberalen und Demokraten angeführt, die den Kapitalismus nicht antasteten. Und die linksreformistischen Führer in Europa und Nordamerika standen ebenfalls fest auf dem Boden des Kapitalismus.
Tsipras in Griechenland hätte mit dem Kapitalismus brechen können, als 61% in einem Volksbegehrens 2016 gegen die von der EU diktierten Sparmaßnahmen stimmten und er gleichzeitig Premierminister war. Er hätte die Banken und Großkonzerne enteignen können und die Massen mobilisieren können, um die Gegenwehr der Kapitalisten zurückzuschlagen. Das wäre ein Beispiel für die Massen in ganz Europa gewesen. Doch der politische Horizont der Reformisten reicht nicht über den Kapitalismus hinaus. Und so mussten sie verraten und die Sparmaßnahmen umsetzen.
Der Verrat der Linksreformisten führte auch zur Stärkung der rechten Demagogen, weil sie nun scheinbar als einzige radikale Opposition zu den etablierten Parteien übrigblieben. Das zeigt der Erfolg Trumps in den USA, nachdem Bernie Sanders 2016 dazu aufgerufen hatte, die Kandidaten des Großkapitals, Hillary Clinton, zu unterstützen.
Zeit für eine neue Führung
Trotzkis Worte von 1938 waren noch nie so aktuell wie heute: „Die historische Krise der Menschheit läuft hinaus auf die Krise der revolutionären Führung des Proletariats.“ Deswegen bauen wir die RKI auf, als eine Kraft, die in der Zukunft die reformistischen Führer an der Spitze der Arbeiterbewegung durch echte Revolutionäre ersetzen kann.
Auch heute stützen wir uns vor allem auf die Jugend! Die ältere Generation des Proletariats hat in den letzten 50 Jahren viele Niederlagen miterlebt. Viele sind zwar sehr wütend auf die bestehenden Zustände gleichzeitig aber auch auf eine gewisse Art resigniert. Vor allem halten die reformistischen Führer der DGB-Gewerkschaften und der SPD sie passiv.
Die Führer dieser Organisationen haben die Arbeiterklasse in den letzten 40 Jahren in eine kampflose Niederlage nach der anderen geführt: Zerstörung der DDR-Volkswirtschaft durch die Treuhand nach der Wende, Schröders Agenda 2010, Deindustrialisierung im Ruhrgebiet, Aufbau eines gigantischen Niedriglohnsektors etc. Damit haben sie viele demoralisiert und das Vertrauen der Arbeiterklasse in ihre eigene Kraft untergraben.
Die heutige Jugend hingegen hat diese Niederlagen nicht miterlebt. Sie kennt seit sie denken kann nichts als die Krise! Sie gruseln sich mehr vor dem realexistierenden Kapitalismus mit all seinen alltäglichen Schrecken als vor den Gruselmärchen vom Kommunismus. Im Gegenteil: Ein wachsender Teil sucht nach den Ideen des Kommunismus! Noch mehr wollen endlich für Palästina, gegen den Klimawandel, gegen Kriege und die Herrschaft der Milliardäre kämpfen! Sie suchen nach einem Weg wie das geht. Diesen Weg zeigt ihnen unter anderem Trotzkis Übergangsprogramm auf.
Aus historischen Gründen blieben die wirklichen Marxisten nach dem Zweiten Weltkrieg eine kleine, isolierte Strömung, die gegen den Strom schwamm. Heute beginnt sich das Blatt zu wenden. Stalinistische Massenparteien gibt es kaum noch und der Reformismus diskreditiert sich immer mehr, weil er in der kapitalistischen Krise keine Reformen erkämpfen kann.
Die erste und wichtigste Aufgabe der revolutionären Kommunisten heute ist die Bewahrung und das Studium der unverfälschten Ideen des Marxismus und seiner Methode. Aber um die Avantgarde der Jugend und der Arbeiterklasse zu gewinnen, die danach die Massen gewinnen werden, braucht sie auch heute noch die Übergangsmethode.