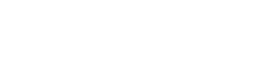Im Jahr 2024 vergrößerten die Milliardäre weltweit ihr Vermögen um 2 Billionen Dollar. Gleichzeitig soll die arbeitende Mehrheit immer länger und härter arbeiten. Das bringt die Stimmung in der Arbeiterklasse zum Brodeln. Die Tötung des CEO von UnitedHealth durch Luigi Mangione im letzten Dezember zeigte eindrucksvoll diese Wut gegen Milliardäre in der amerikanischen Bevölkerung. Auf die Tat folgte keine moralische Entrüstung, sondern massenhafte Solidarität mit dem verhafteten Schützen. Denn Millionen US-Amerikaner erleben die betrügerischen Geschäftspraktiken der Versicherungsgesellschaften im Gesundheitssektor am eigenen Leib.
Diese wachsende Ablehnung gegenüber Reichen hat der reformistischen Linken neuen Auftrieb gegeben. Seit Trumps Wahlsieg zieht etwa Bernie Sanders angesichts steigender Lebenshaltungskosten mit seiner „Fight Oligarchy Tour“ Zehntausende an. In Deutschland konnte DIE LINKE mit fast 9% ihren Stimmenanteil verdoppeln. Grund hierfür war vor allem ihr kämpferischeres Auftreten, sowie die Forderung zur Abschaffung von Milliardären. Das und andere soziale Probleme wollen linke Reformisten grundsätzlich durch höhere Steuern für Reiche lösen. Die Kluft zwischen Arm und Reich soll durch eine solche Umverteilung wieder verringert werden.
Dieser Ansatz scheint zunächst schlüssig. In den letzten Jahrzehnten haben bürgerliche Regierungen durch ihre Steuerpolitik diese Kluft ausgedehnt. Besonders seit den 1990er Jahren erhielten Kapitalisten massive Steuergeschenke: In Deutschland wurde die Körperschaftsteuer drastisch gesenkt und 1997 die Vermögenssteuer komplett ausgesetzt. Heute werden durchschnittliche Arbeitseinkommen mit 47,9% besteuert, während Milliardäre oft nur die Hälfte entrichten.
Zugleich führen Inflation, prekäre Arbeitsverhältnisse und Austeritätspolitik zu brutalen Angriffen auf den Lebensstandard der Arbeiterklasse. Entsprechend erscheint es naheliegend, nun den Reichen einen Teil ihres Vermögens zu nehmen und so das soziale Gleichgewicht wiederherzustellen. Doch historisch ist jeder Versuch, einen langfristigen Kompromiss in der Verteilungsfrage mit den Reichen zu finden, an den grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus gescheitert.
Was ist der Kapitalismus?
Karl Marx hat als erster die Funktionsweise des Kapitalismus vollständig herausgearbeitet. Als Ausgangspunkt für seine Analyse untersucht er in seinem dreibändigen Werk „Das Kapital“ den Grundbaustein des Kapitalismus, die Ware. Er erklärt: „Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung.“
Die Kapitalisten produzieren als Eigentümer der Produktionsmittel (Fabriken, Felder usw.) alle Waren allein für den Austausch. Doch sie tauschen ihre Waren nicht einfach gegen andere Waren ein, die sie gerade benötigen und vorfinden. Stattdessen tauschen sie ihre Waren auf einem Markt gegen Geld. Denn mit diesem universellen Tauschmittel können sie später jede andere Ware erwerben. Die Kapitalisten wollen durch den Verkauf ihrer Waren Profite machen und diese kontinuierlich steigern, indem sie sie in die Produktion reinvestieren, um mehr Waren verkaufen oder zum Ausstechen der Konkurrenz effizienter produzieren zu können.
Dieses System hat zwangsläufig einen chaotischen Charakter. Es gibt keinen gesamtgesellschaftlichen Überblick über die Produktion. Allein die Profitinteressen der konkurrierenden Kapitalisten sind ausschlaggebend dafür, was produziert wird und wohin Investitionen fließen. Der Preis einer Ware erscheint uns deshalb schnell als eine unerklärliche Eigenschaft.
Doch der Warentausch ist nichts Übernatürliches, sondern wird von Menschen gemacht. Da die gesamte Wirtschaft auf Warentausch basiert, sind alle abhängig von dem, was die anderen produzieren. Aus diesem Grund muss es zwangsweise ökonomische Gesetze geben, die bestimmen, zu welchen Bedingungen getauscht wird.
Die Arbeitswerttheorie
Im Zentrum jeder Warentauschbeziehung steht der Tauschwert: Er macht möglich, dass unterschiedliche Gebrauchswerte – also Waren mit verschiedenen nützlichen Eigenschaften – quantitativ vergleichbar werden.
Alle Waren haben gemeinsam, dass sie durch menschliche Arbeit entstanden sind. Marx’ Arbeitswerttheorie führt den Tauschwert auf die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zurück, die zur Produktion einer bestimmten Ware aufgewendet werden muss. Bereits der bürgerliche Ökonom Adam Smith erkannte Arbeit als „ursprüngliches Geld“, mit dem alle Reichtümer der Welt zuerst erworben wurden. Dabei messen wir nicht die konkrete, handwerkliche Tätigkeit eines einzelnen Produzenten, sondern abstrahieren sie zur in allen Arbeiten gleichen abstrakten Arbeit.
Erst auf dieser Ebene wird Vergleichbarkeit möglich: Ein Tischler und ein Holzfäller verrichten unterschiedliche konkrete Arbeiten, doch lassen sich ihre Produkte über die dafür erforderliche Arbeitszeit ins Verhältnis setzen. Entscheidend ist dabei nicht die individuelle Arbeitsdauer, sondern die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit – ein Durchschnittswert, der im Konkurrenzkampf zwischen den Produzenten entsteht. Wer länger braucht als diese Durchschnittsdauer, kann seine Ware nicht teurer anbieten, ohne Käufer an effizientere Konkurrenten zu verlieren.
Werte sind also ein soziales Verhältnis aber keine materielle Größe. Sie können weder über physische Eigenschaften noch über die individuellen Gebrauchsvorstellungen der Menschen bestimmt werden. Luft zum Atmen oder ein malerischer Sonnenaufgang mögen einen Gebrauchswert besitzen, kosten aber nichts und zeigen, dass Nützlichkeit und Tauschwert auseinanderfallen.
Dass Marktpreise in der Realität dennoch vom Tauschwert abweichen, ist kein Widerspruch, sondern Ausdruck der anarchischen Produktionsweise des Kapitalismus. Angebot und Nachfrage signalisieren, ob sich Investitionen lohnen, und treiben Preise kurzzeitig über oder unter den tatsächlichen Tauschwert. Letztlich spiegelt sich die unterschiedliche notwendige Arbeitszeit für die Produktion der Waren aber auch in den Preisen wider: Für einen Ziegelstein würden wir niemals mehr bezahlen als für einen Neuwagen.
Woher kommt der Profit?
Aus der Arbeitswerttheorie folgt, dass die Kapitalisten ihre Profite durch die Ausbeutung der Arbeiterklasse machen. Dieser offensichtliche Umstand wird aber von bürgerlichen Ökonomen geleugnet. Denn aus ihm lässt sich der krisenhafte Charakter des Kapitalismus nachweisen.
Die Ausbeutung der Arbeiterklasse resultiert aus ihrer sozialen Lage. Im Gegensatz zu den Kapitalisten besitzt die Mehrheit der Bevölkerung keine Produktionsmittel. Um ihren eigenen Lebensunterhalt finanzieren zu können, muss sie die einzige Ware verkaufen, die sie besitzt: ihre Arbeitskraft.
Arbeitskraft ist die menschliche Fähigkeit, der Natur zielgerichtet neue Gebrauchswerte abzuringen. Die Kapitalisten kaufen diese Ware aufgrund dieser einzigartigen Eigenschaft.
Der Wert der Ware Arbeitskraft wird, wie bei allen anderen Waren, durch die in ihr enthaltene gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt. Der Kapitalist muss also dem Arbeiter gerade so viel bezahlen, dass er sich Lebensmittel, Unterkunft und Erholung leisten kann. Außerdem muss es ihm möglich sein, Kinder großzuziehen, die später einmal seinen Posten einnehmen. Zahlt der Kapitalist weniger, kann sich die Ware Arbeitskraft nicht nachhaltig reproduzieren.
Dieses Verhältnis scheint zunächst ein fairer Tausch zu sein. Der Arbeiter stellt dem Kapitalisten seine Fähigkeit zu arbeiten zur Verfügung, der Kapitalist gibt dem Arbeiter durch den Lohn die Fähigkeit sich zu erhalten und zu reproduzieren. Doch mit entsprechenden Werkzeugen und Wissen sind Menschen in der Lage der Natur mehr Produkte abzuringen, als sie zum bloßen Überleben benötigen. Diesen sogenannten Mehrwert eignet sich der Kapitalist an und realisiert so auf dem Markt seine Profite. Wenn ein Kapitalist einen Arbeiter für acht Stunden am Tag einstellt, hat der Arbeiter vielleicht schon nach vier Stunden den Wert erarbeitet, der seinem Lohn entspricht. Die restlichen vier Stunden arbeitet er dann praktisch unbezahlt für den Kapitalisten. Kein Kapitalist wird dem Arbeiter den vollen Wert seiner Arbeit auszahlen, denn das würde für den Kapitalisten einen Wegfall jeglicher Profite bedeuten.
Der Wert einer Ware setzt sich somit aus drei Bestandteilen zusammen. Der Kapitalist muss zunächst Rohstoffe und Maschinen für die Produktion erwerben, die bereits von anderen Produzenten hergestellt wurden. Er muss dem Arbeiter einen Lohn zahlen. Und zu guter Letzt streicht er unbezahlte Arbeit als Mehrwert ein.
Die Widersprüchlichkeit des Kapitalismus
Für eine Zeit konnte der Kapitalismus auf dieser Basis enormen Fortschritt erreichen. Da die Kapitalisten darum konkurrieren, wer die meisten Waren auf dem Markt profitabel verkaufen kann, investierten sie ihre Profite wieder in die Entwicklung der Produktion, um mehr Waren in kürzerer Zeit produzieren zu können. Das machte die Waren günstiger, weil weniger Arbeitszeit für ihre Produktion benötigt wurde, und es weitete die Produktion aus. Um die wachsende Warenmasse abzusetzen, erschlossen sie sich die ganze Welt als Markt, und reinvestierten ihre Profite wiederum in noch größerem Umfang in die Produktion. Die Ausbeutung der Arbeiterklasse ermöglichte diesen Prozess, weil sie den Kapitalisten den nötigen Profit zum Investieren erbrachte. Doch ab einem gewissen Zeitpunkt entwickelt sich diese Wirkung in ihr Gegenteil. Da die Arbeiterklasse mehr produziert, als sie zu ihrer Reproduktion benötigt, ist sie nicht in der Lage, die Waren, die sie produziert, zurückzukaufen.
Das kann für den Kapitalismus eine Zeit lang gut gehen, da die Kapitalisten ihre Waren nicht nur an die Arbeiter verkaufen, sondern auch an ihre eigene Klasse, die Maschinen, Rohstoffe, Fabriken, Lagerhallen usw. Benötigt. Die Ausweitung der Nachfrage kann irgendwann nicht mehr Schritt halten mit der Ausweitung der Produktion. Ab einem gewissen Punkt können die Kapitalisten die neuen Waren nicht mehr profitabel verkaufen, weil das Angebot die Nachfrage übersteigt. Sie befinden sich in einer Überproduktionskrise.
Um sich wirtschaftlich über Wasser zu halten, tun sie alles, um ihre Profite zu retten. Mangels genügend profitabler Investitionsmöglichkeiten schließen sie unrentable Fabriken oder kürzen bei den Löhnen, um die Verluste auszugleichen. Durch Letzteres sowie die Erschließung neuer Märkte und gründlichere Ausnutzung ihrer bestehenden Märkte können sie es schaffen, eine neue Wachstumsperiode zu erreichen, bis sich der ganze Zyklus wiederholt.
Das Absurde an diesem Vorgang ist, dass andere Gesellschaften in Krisen gekommen sind, weil sie zu wenig produziert haben, während der Kapitalismus in die Krise geht, weil er zu viel Reichtum, zu viele nützliche Gebrauchsgegenstände produziert hat.
Zwar kann der Kapitalismus seine Krisen zeitweise überbrücken, doch die Möglichkeit zu expandieren wird für die Kapitalisten immer enger, desto mehr Krisen stattfinden. So wie die Kapitalisten ihre Produktion ausweiten, verschlimmern sie auch die soziale Ungleichheit. Die ständigen Investitionen in neue Industrien führen dazu, dass der Anteil der Arbeit am Reproduktionsprozess der Arbeiterklasse geringer wird und der relative Reichtum in den Händen der Arbeiterklasse schrumpft. Die Arbeiter produzieren also mit zunehmendem technischen Fortschritt immer größere Überschüsse, die sie allerdings nicht zurückkaufen können. Auch die Erschließung neuer Märkte kann dem nicht ewig entgegenwirken, da die ganze Welt längst unter den Kapitalisten aufgeteilt ist. Der Zyklus von Wachstum und Krise entwickelt sich statt wie ein Kreislauf wie eine Spirale. Die Aufschwünge werden schwächer und die Krisen härter. Irgendwann kommt der Kapitalismus an einen Punkt, an dem es ihm kaum noch gelingt, ein neues Gleichgewicht zu finden. Er kommt in eine organische Krise, die von langwieriger stagnierender Entwicklung der Produktion und zerfallendem Lebensstandard geprägt ist.
Der Kapitalismus lässt keine wirksamen Reformen mehr zu
Das ist genau der Zustand, in dem sich der Kapitalismus heute befindet. Die Finanzkrise 2008 war Ausdruck einer Überproduktionskrise, der nur eine schwache Erholung folgte. Eine erneute Krise brach kurz vor der Coronapandemie aus und wurde durch sie verstärkt.
Um dem Investitionsstau und sinkendem Wirtschaftswachstum entgegenzuwirken, sind die kapitalistischen Staaten auf der ganzen Welt gezwungen, den Kapitalisten unter die Arme zu greifen, indem sie die Steuern für sie senken und ihre Unternehmen subventionieren. Andernfalls müssten die Kapitalisten ihre Investitionen, mangels profitabler Anlagemöglichkeiten, massiv dämpfen oder würden sich einfach im Ausland nach profitableren Optionen umschauen. Ohne Investitionen, um die Produktion am Laufen zu halten, würde die heimische Wirtschaft noch tiefer in die Krise rutschen.
Aus diesem Grund haben die Herrschenden keine andere Wahl als Angriffe auf den Lebensstandard der Arbeiterklasse in Form von z.B. härterer Ausbeutung, Kürzungen bei Bildung, der Gesundheit und dem Sozialstaat durchzuführen.
Befürworter der Reichensteuer argumentieren zwar, dass in den westlichen kapitalistischen Ländern bis vor gut dreißig Jahren Unternehmen sehr wohl deutlich stärker besteuert wurden und es einen stärkeren Sozialstaat gab. Doch das geschah in einer Phase des ökonomischen Aufschwungs, der es den Kapitalisten erlaubte, Zugeständnisse an die Arbeiterklasse zu tolerieren. Heute ist das Gegenteil der Fall.
Eine linke Regierung, die mitten in der kapitalistischen Krise versucht, die Kürzungen rückgängig zu machen, indem sie die Reichen mehr besteuert, würde auf heftigsten Widerstand der Kapitalisten stoßen, die die ganze Wirtschaft unter ihrer Kontrolle haben. Ohne wirtschaftlichen Aufschwung können Reformen nicht finanziert werden.
Die von 2012 bis 2017 amtierende sozialdemokratische Regierung in Frankreich unter Francois Hollande hat bildhaft gezeigt, dass die Kapitalistenklasse in der organischen Krise keine fortschrittlichen Reformen zulässt. Hollande wurde für sein Programm gewählt, das eine 75% Einkommensteuer für Reiche, öffentliche Investitionen in die Industrie und einige kleinere soziale Reformen versprach. Umsetzen konnte er davon so gut wie nichts.
Obwohl er das Steuerprogramm nur zum Teil durchsetzte, reduzierten die Kapitalisten ihre Investitionen enorm, teils aus ökonomischen Gründen, teils um die Regierung zu zwingen, sie zurückzunehmen.
Die staatlichen Investitionen scheiterten teilweise daran, dass die Überproduktionskrise sich schon auf der ganzen Welt ausgebreitet hatte. Die exportabhängige Industrie hätte das Geld zwar nutzen können, um neue Waren zu produzieren, aber sie hätten sie kaum profitabel verkaufen können. Zwar hat der Staat versucht, durch z.B. öffentlichen Ausbau der Infrastruktur die Nachfrage zu erhöhen, doch er hatte nicht das Geld, um seine Programme dauerhaft aufrechtzuerhalten. Einige Kapitalisten konnten hier einmalig einen Profit machen, aber insgesamt ist der Markt nicht gewachsen und die Investitionen blieben gering. Wegen der Anarchie des Marktes konnte die Regierung mit ihrer Wirtschaftspolitik außerdem nicht auf die Bedürfnisse aller einzelnen Kapitalisten eingehen. Viele gingen leer aus und haben nur Verluste durch die höheren Steuern gemacht. Um den Widerstand der Kapitalisten aufzulösen, musste Hollande schließlich das genaue Gegenteil seines Programms durchsetzen: Er reduzierte die Steuern für Unternehmen und flexibilisierte die Tarifverträge, Arbeitszeiten und den Kündigungsschutz.
Als Norwegen 2022 seine Vermögenssteuer auf bescheidene 1,1% erhöhte, verließen superreiche Kapitalisten in Scharen das Land, was zu viele Millionen schweren Lücken im norwegischen Staatshaushalt führte. Die freundlichen Bitten der norwegischen Regierung, diese Individuen mögen bitte aus dem sonnigen Lugano in der Schweiz zurück nach Norwegen kommen, blieben unbeachtet.
Reformisten behaupten, das Problem der Kapitalflucht könnte vermieden werden, indem man Vermögen an die Staatsbürgerschaft knüpft. So könnten die Kapitalisten auch besteuert werden, wenn sie ihr Kapital aus dem Land schaffen. Doch das würde nach wie vor bedeuten, dass die Investitionen in die eigene Wirtschaft fehlen würden. Ist die Produktion durch Investitionsmangel lahmgelegt, gibt es keine Waren, die man kaufen kann. Das durch Steuern erhobene Geld wird also zunehmend wertlos.
Für ein sozialistisches Wirtschaftsprogramm
DIE LINKE fordert eine Vermögenssteuer von 1% ab einem Vermögen von 1 Million € und 5% ab 50 Millionen €. Die erste Frage, die sich aufdrängt, lautet: Warum sollen die anderen 99% bzw. 95% des aus unserer Arbeit entstandenen Vermögens weiter auf den Schweizer Bankkonten schlummern, statt im Sinne der Allgemeinheit investiert zu werden?
Wie wir gesehen haben, werden die Kapitalisten alles tun, um eine Vermögenssteuer zu verhindern: Mit Kapitalflucht und Investitionsstreiks. Wollte man die Vermögenssteuer also konsequent aufrechterhalten, müsste man zum einen alle Kapitalisten enteignen, die durch Kapitalflucht ihr Vermögen dem staatlichen Zugriff entziehen. Denn Nichtinvestieren in die heimische Wirtschaft würde die Vermögenssteuer sabotieren. Letztlich hätte man dann den Großteil der Kapitalisten enteignet und die meisten Wirtschaftssektoren in staatlicher Hand.
Die Reformisten haben eine falsche Analyse des Kapitalismus, sind sie nicht in der Lage, ein korrektes Programm aufzustellen. Sie glauben, kosmetische Eingriffe in die Verteilung der Waren würden genügen, um spürbare Verbesserungen für die Arbeiterklasse herzustellen. In der Realität ist das jedoch eine utopische Vorstellung. Da der Profit das treibende Motiv im Kapitalismus ist, führt jeder Versuch, ihn zu beschneiden, zu wirtschaftlichen Problemen. In der Überproduktionskrise, wo die Märkte überfüllt sind und die Kapitalisten deshalb in noch viel verbitterterer Konkurrenz um die verbliebenen Profite stehen, ist das noch viel eher der Fall. Weil der Reformismus mit der Realität in Konflikt gerät, befindet er sich in einem Teufelskreis. Er fängt die Wut der Arbeiter über ihre Ausbeutung auf, indem er ihnen soziale Verbesserungen verspricht. Doch weil er den Kapitalismus als Wirtschaftssystem verteidigt, kann er nur Reformen durchsetzen, wenn die ökonomische Lage das zulässt. Tut sie das nicht, können die Reformisten ihre Reformen nicht nur nicht durchsetzen, sondern sind sogar gezwungen, die Profite der Kapitalisten zu retten, aus Angst ein Kollaps der Wirtschaft würde noch Schlimmeres bedeuten. Das haben die Regierung Hollande und zahlreiche andere Beispiele eindringlich bewiesen.
Als Kommunisten sind wir nicht gegen Reformen. Auch wir sind der Ansicht, dass der Reichtum der Kapitalisten umverteilt werden muss, um der sozialen Verelendung entgegenzuwirken. Wir sind für jeden Kampf für höhere Löhne, gegen Sozialabbau und für eine bessere Stellung der Arbeiterklasse. Doch diese Forderungen können langfristig nur durchgesetzt werden, wenn die Arbeiterklasse selbst die Kontrolle über die Produktion übernimmt. Angefangen mit der Enteignung der größten Betriebe und der Banken, kann die Arbeiterklasse durch einen demokratisch abgestimmten rationalen Produktionsplan selbst entscheiden, wie investiert werden soll. Überproduktionskrisen würden so undenkbar werden. Da nicht mehr für Profit sondern für Bedürfnisse produziert werden würde, könnte die Industrie maximal effizient für die Bereicherung der ganzen Menschheit genutzt werden.