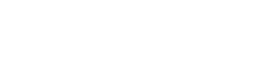Die Massenorganisationen der Arbeiterklasse scheinen heute fest in den Händen der Reformisten zu sein, die jegliche kämpferische Aktivität der Massen unterbinden. Doch der Kampf der Revolutionären Obleute gegen den Burgfrieden im Ersten Weltkrieg zeigt: Die Arbeiter können den Bremsklotz, den die Gewerkschaftsbürokratie verkörpert, beiseiteschieben und durch ihre Selbstaktivität radikale Schlüsse ziehen. Denn es waren die Obleute, die zum treibenden Faktor der Novemberrevolution von 1918 wurden.
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte offenbart, dass die Führung der Arbeiterorganisationen vollständig auf die Seite der herrschenden Klasse übergegangen war. Die Imperialisten nutzten einen Teil des Reichtums, den sie durch die Ausbeutung der Kolonien und halbkolonialen Länder erzielten, um Teile der Arbeiterklasse und besonders die Bürokratie ihrer Organisation zu bestechen.
Anstatt das Ziel der Revolution zu verfolgen, war der reformistische Apparat in der Sozialdemokratischen Partei (SPD) und den Gewerkschaften davon überzeugt, dass es im Kapitalismus möglich sei, nachhaltige Verbesserungen für die Massen zu erzielen. Sie wurden so zu Verteidigern des Systems. Und dieser Anbiederung folgte offener Verrat an den Interessen der Arbeiterklasse.
Der Burgfrieden
Angesicht der Kriegsgefahr im Sommer 1914 erwarteten viele Arbeiter von ihren Organisationen eine entschlossene Antikriegsposition, basierend auf den Beschlüssen der Kongresse der Zweiten Internationale in Stuttgart (1907), Kopenhagen (1910) und Basel (1912).
Die Resolutionen besagten, dass die Arbeiterklasse und ihre Organisationen den Krieg mit allen Mitteln abwenden müssen. Die Vertreter der Zweiten Internationale verpflichteten sich dazu, geschlossen für das Ende eines Krieges einzutreten, sollte er dennoch ausbrechen.
Noch vor dem Krieg organisierten die Arbeiterorganisationen größere Proteste gegen den drohenden Konflikt. Als er dennoch ausbrach, stellte sich die Führung jedoch auf die Seite des deutschen Imperialismus. Die SPD verriet die Arbeiterklasse, indem sie Kriegskredite bewilligte und Kriegspropaganda schürte.
Auch die Gewerkschaften stimmten dem Kriegstreiben zu und riefen den sogenannten Burgfrieden zwischen Kapital und Arbeit aus. Das bedeutete, dass die Gewerkschaften keine Arbeitskämpfe während des Krieges führen wollten und gleichzeitig mobilisierten sie ihre Mitglieder für das imperialistische Schlachten.
Sie präsentierten dies als Verteidigung der Errungenschaften der Arbeiterbewegung: entweder Burgfrieden oder brutale militärische Unterdrückung der Arbeitskämpfe und Zerschlagung der Gewerkschaften.
Die Politik des Burgfriedens war aber ein einseitiges Stillhalten des Klassenkampfes, denn das Kapital konnte ungehindert seine Interessen weiterverfolgen. Die Arbeiterklasse war unterdessen den Angriffen der Herrschenden schutzlos ausgeliefert. Die Führung der Gewerkschaften stimmte sogar der Aufhebung der Arbeitsschutzgesetze zu.
Zusätzlich dazu akzeptierten sie im Jahr 1916 das Hilfsdienstgesetz, das eine allgemeine Arbeitspflicht für Männer einführte, die nicht im Militär dienten. So konnten die Arbeiter dazu verpflichtetet werden, in kriegswichtigen Betrieben zu arbeiten, und konnten nicht mehr frei wählen, für welchen Kapitalisten sie ihre Arbeitskraft verkauften.
Kriegsopposition
Direkt nach dem Verrat der SPD versammelte sich eine kleine Gruppe von Revolutionären: Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Clara Zetkin, Franz Mehring und andere. Diese Revolutionäre stellten sich gegen den Krieg und den Imperialismus und gründeten während des Krieges den Spartakusbund, aus dem später die KPD entstand.
Auch innerhalb der Gewerkschaften gab es von Anfang an eine Opposition zur Politik des Burgfriedens. In der ersten Sitzung des Berliner Ortsverbandes des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes (dem Vorgänger der IG Metall) nach dem Ausruf des Burgfriedens kündigte ein Arbeiter an, dass die Berliner Dreher das Streikverbot nicht mittragen würden. Dieser Arbeiter war Richard Müller, der später Anführer der Revolutionären Obleute wurde.
Ab 1914 provozierten die Dreher immer wieder wilde Streiks – also Arbeitskämpfe ohne die Zustimmung der reformistischen Gewerkschaftsführung. Sie gaben sich nicht mit den durch den Krieg fallenden Lebensbedingungen zufrieden und widersetzten sich dem Burgfrieden. Anfangs beschränkten sich diese Streiks auf Lohnforderungen. Doch während des Burgfriedens hatte jeder Streik einen hoch politischen Charakter.
Richard Müller führte ein oppositionelles Netzwerk aus erfahrenen gewerkschaftlichen Vertrauensleuten an. Offizielle Gewerkschaftsversammlungen wurden zur Kriegszeit nicht verboten, aber bespitzelt. Deswegen nutzten die Vertrauensleute die Kneipenabende nach den Veranstaltungen, um sich auszutauschen und um neue Verbündete zu finden, und führten Flurgespräche bei den Versammlungen. Trotz ihrer geringen Mitgliederanzahl wuchs ihr Einfluss enorm an.
Ein Obmann vertrat ein Werk oder einen Betrieb und dieser hatte innerhalb dessen weitere Vertrauensleute. So konnten sie Hunderttausende Berliner Arbeiter erreichen.
Massenstreik und Bewusstsein
Vor 1918 hatte die Gruppe noch kein revolutionäres Bewusstsein. Doch die Massenstreiks, die während des Ersten Weltkrieges stattfanden, radikalisierten sie nach und nach. Bereits 1915 gab es größere Proteste in Deutschland, denn die Lebensmittel wurden teurer und viele Arbeiterfamilien mussten Hunger leiden. Ende Mai 1915 demonstrierten deswegen Arbeiterfrauen für Frieden und Brot.
Nach dem 1. Mai 1916 erlebten die Obleute einen Bewusstseinswandel. Der Spartakusbund mobilisierte erstmals mehrere Tausend Menschen. Liebknecht hielt eine Rede gegen den Krieg und wurde festgenommen. Er wurde zum Symbol des Widerstands, auch für die Obleute. Denn bei der zweiten Abstimmung zu den Kriegskrediten stimmte er als einziger dagegen. Sein Werk „Militarismus und Antimilitarismus“ wurde unter Arbeitern energisch diskutiert und als Sohn des SPD-Mitbegründers Wilhelm Liebknecht war er bereits vor dem Krieg bekannt.
Als die Obleute später zum Streik für die Befreiung Liebknechts ausriefen, fanden sie in Berlin großen Zuspruch. Sie mobilisierten 55.000 Menschen auf die Straße. So verließen sie erstmals das Terrain der Streiks um Lohnforderungen und mobilisierten für einen politischen Streik.
Weitere Streiks folgten 1917. Wegen der britischen Seeblockade und einer schlechten Ernte herrschte akuter Nahrungsmangel. Die Menschen litten und die Kriegsmüdigkeit nahm zu. Die Gewerkschaftsführung und das Kriegsamt unterbanden jedoch die Streiks immer wieder.
Doch die Stimmung blieb unverändert und mündete in die Aprilstreiks von 1917. Die Obleute waren stark in den Betrieben verankert und spürten die Stimmung der Arbeiterklasse direkt. Sie wussten besser als alle anderen, wann die Zeit für größere Streiks reif war. Gleichzeitig waren in Berlin ohne ihre aktive Beteiligung kaum breite Massenaktionen möglich.
Die Aprilstreiks richteten sich gegen Kürzungen der Brotrationen und gegen das Hilfsdienstgesetz. Ebenso forderten die Streikenden Frieden, gleiches Wahlrecht und Koalitionsfreiheit. Die Massenstreiks 1917 richteten sich so gegen den Imperialismus und auch gegen die Politik der Arbeiterorganisationen.
Das Jahr 1918
Die Massenstreiks 1916 und 1917 haben die Obleute stark radikalisiert, aber auch der Erfolg der Russischen Revolution von 1917. Erstmals in der Geschichte hatten die Arbeiter die Macht ergriffen und begannen die sozialistische Umwälzung.
Davon waren viele Arbeiter auf der Welt inspiriert. So mobilisierten auch die Obleute schon für sozialistische Forderungen beim Januarstreik 1918. Dieser Streik legte die gesamte Rüstungsindustrie innerhalb weniger Stunden lahm.
In Berlin gingen 400.000 Arbeiter auf die Straße. Sie forderten Frieden ohne Annexionen und Entschädigungen, die Beteiligung von Arbeitervertretern an den Friedensverhandlungen, ein Ende des Belagerungszustands, Pressefreiheit und das Ende der militärischen Einmischung in Gewerkschaftsangelegenheiten. Erstmals forderten sie auch die Demokratisierung der Staatseinrichtungen und das allgemeine Wahlrecht, einschließlich das der Frauen.
Diese Massenaktion war zwar nicht erfolgreich, aber die Arbeiterklasse erhob sich erneut. Am 3. November 1918 meuterten die Soldaten in Kiel und entfachten die Novemberrevolution. Die Obleute spielten eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung der Bewegung.
Den Kommunisten aber gelang es nicht, sich mit ihnen zu verbinden. Erst im Sturm der Ereignisse bauten sie die KPD auf. Zwar nahmen bei deren Gründungsparteitag auch die Obleute teil. Doch die junge Partei war von Kinderkrankheiten geprägt: Zum Beispiel verweigerten die unerfahrenen KPD-Genossen die Arbeit in den Gewerkschaften und im Parlament.
Das schreckte die Obleute ab. Sie wurden nicht Teil der KPD, die deswegen isoliert von einem entscheidenden Teil der Arbeiterklasse blieb. Die Deutsche Revolution 1918/1919 endete in einer Niederlage, weil die Kommunisten unvorbereitet waren.
Doch das Beispiel der Revolutionären Obleute zeigt, dass die Arbeiterklasse ihre reformistische Führung überwinden kann, auch wenn dieser mächtige Apparat sie zurückhalten will. Im Klassenkampf öffnet sie sich für revolutionäre Positionen. Die Aufgabe von Kommunisten ist es, daran anzuknüpfen zu können. Deshalb bereiten wir uns heute darauf vor.