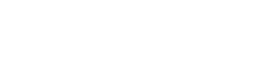Vom 14. bis 17. März fand in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes (TVöD) statt – betroffen sind über 2,5 Millionen Beschäftigte: Krankenhäuser, Kitas, Flughäfen, Nahverkehr, Kläranlagen, Müllentsorgung und vieles mehr. Die Tarifverhandlungen sind besonders brisant, weil die Gewerkschaften direkt mit staatlichen Vertretern verhandeln. Nach wochenlangen Verhandlungen ist die Anspannung immer noch greifbar.
Auch vor dieser Runde gingen rund 150.000 Beschäftigte in den Streik. Am 13. März legten 15.000 Streikende Hannover lahm. In Hamburg blockierten 150 Hafenarbeiter den Betrieb. In Düsseldorf legte ein 48-stündiger Streik der Rheinbahn fast den gesamten Nahverkehr lahm.
Die Botschaft: Als Motor dieser Gesellschaft können die Arbeiter das öffentliche Leben stilllegen, und das tun sie auch, wenn ihre Forderungen ignoriert werden.
Die Gewerkschaften fordern 8 % mehr Lohn, mindestens 350 Euro pro Monat und drei zusätzliche Urlaubstage. Das Angebot von staatlicher Seite ist lächerlich: 5,5 % schrittweise über vier Jahre verteilt – mit Nullrunde im ersten Jahr, dann nur 2 %, 2 % und 1,5 %. Das bedeutet weiter krasse Reallohnverluste für viele Arbeiter.
Trotzdem bezeichnete Innenministerin Nancy Faeser (SPD) diesen Vorschlag als „spürbare Verbesserung“ – während Bundestagsabgeordnete sich selbst eine Gehalterhöhung von 6 % für 2024 und 5,4 % für 2025 gönnen.
Nach Scheitern der Verhandlungen ist im Tarifvertrag festgelegt, dass ein Schlichtungsprozess eingeleitet wird. Zwei Männer haben nun ein weiteres Verhandlungsangebot erarbeitet:
Hans-Henning Lühr (SPD), Ex-Finanzsenator Bremen – verhandelt für die Gewerkschaften und war bereits beim letzten Schlichtungsprozess 2023 verantwortlich. Ergebnis war ein schlechter Tarifabschluss mit 14-monatiger Nullrunde und mickrigen Erhöhungen, die nicht mal ansatzweise die steigenden Lebenskosten ausgleichen konnten.
Roland Koch (CDU), Ex-Ministerpräsident Hessen, einst als „bester Mann von Angela Merkel“ bezeichnet, verhandelt für die staatliche Seite und kann im Falle eines Patts den entscheidenden Vorschlag selbst festlegen. Der Budgetrahmen des Staates ist bereits in den drei Verhandlungsrunden deutlich geworden: Während für Rüstung Geld da ist und die Schuldenbremse gelockert wird, soll bei Pflegekräften, Busfahrern und Reinigungskräften weiter gespart werden.
Angesichts einer solchen Schlichtungskommission ist die am 28. März veröffentlichte „Empfehlung“ eine logische Konsequenz:
Obwohl die Schlichtung auf den ersten Blick Lohnerhöhungen verspricht, entpuppt sich dies bei näherer Betrachtung als gezielte Augenwischerei. Die vorgeschlagenen nominalen Erhöhungen – 3 % ab April 2025 und 2,8 % ab Mai 2026 – wirken angesichts der dramatischen Preissteigerungen der letzten Jahre wie ein Hohn. In den Jahren 2022 bis 2024 lag die kumulierte Inflation bei rund 20 % (2022: 7,9 %, 2023: 6,5 %, 2024: ca. 5,2 %). Besonders betroffen waren Grundbedürfnisse: Energie, Wohnen, Lebensmittel – genau die Bereiche, auf die Arbeiter im unteren und mittleren Einkommensbereich den Großteil ihres Gehalts verwenden.
Warum eine Laufzeit von 27 Monate? Das beantwortet der Vorsitzende der Schlichtungskomission Roland Koch selbst: „Aber jetzt muss in den kommenden zwei Jahren niemand mehr Einschränkungen durch Arbeitskämpfe im bei Weitem größten Tarifbereich Deutschlands befürchten.“ Auch der nächste Tarifvertrag soll die Arbeiter des öffentlichen Diensts mit langer Laufzeit fesseln.
Über die Schlichtungsempfehlung werden nun die Gewerkschaften und staatlichen Vertreter am Samstag, dem 5. April 2025, erneut in Potsdam verhandeln. Die bestehende Friedenspflicht dauert an.
Was jetzt folgt, darf kein fauler Kompromiss am Verhandlungstisch sein. Die Schlichtungsempfehlung ist kein Fortschritt – sie ist ein Angriff auf die Löhne der Arbeiter im öffentlichen Dienst, verkleidet als „Kompromiss“. Sie zementiert Reallohnverluste, schafft keine sozialen Verbesserungen, sondern sichert dem Staat Haushaltsdisziplin und Ruhe vor dem nächsten Streik. Wer diesen Vorschlag annimmt, verrät die Streikenden von Hannover, Düsseldorf und Hamburg – und beerdigt den Mut von über 150.000 Arbeitern, die gezeigt haben, dass der öffentliche Dienst nicht nur funktioniert, sondern auch stillstehen kann.
Ein Funke bei der BVG
DieArbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben es vorgemacht: In Berlin üben die Arbeiter der Verkehrsbetriebe mit einer kämpferischen Basis massiven Druck auf die zögerliche Linie der Gewerkschaftsführung aus. Nach dem Scheitern der sechsten Verhandlungsrunde zwischen der BVG und der Gewerkschaft ver.di, in der die Unternehmensseite kein akzeptables Angebot vorlegte, rief ver.di zu einem 48-stündigen Warnstreik auf.
Bevor die Schlichtung am 28. März startete und damit ein Streikverbot gilt, traten vom 26. bis 27. März 14.500 Arbeiter der BVG und der Tochterfirma BT zum fünften Mal in den Streik. Ihre Forderungen sind klar und berechtigt: Eine 36,5-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, die Anerkennung von Nacht- und Wochenendarbeit auch für Neueingestellte und spürbare Lohnerhöhungen. Die Kampfbereitschaft ist groß: Bereits am 10. Februar hatte die Belegschaft mit einem 40-Tage-Ultimatum erklärt, für ihre Forderungen falls nötig auch länger in den Streik zu treten. Ein unbefristeter Streik wird von vielen Arbeitern gefordert angesichts der mangelhaften Angebote der Unternehmensseite. Deswegen wurde parallel zum Warnstreik eine Urabstimmung unter den rund 16.000 BVG-Arbeitern initiiert über die Durchführung eines unbefristeten Streiks. Diese Abstimmung begann am 26. März und soll bis zum 4. April andauern.
Angesichts dieser kämpferischen Stimmung ist es umso enttäuschender, dass die Gewerkschaftsführung von ver.di trotz laufender Urabstimmung dieser Schlichtung am 26. März zugestimmt hat, obwohl im Gegensatz zum TVöD dazu kein vertraglicher Zwang besteht. Anstatt die Druckmittel der Streikenden weiter auszubauen, hat die Gewerkschaftsführung den Widerstand komplett ausgebremst und die Kampfbereitschaft in eine Sackgasse gelenkt.
In den Medien werden nun die beiden Schlichter Bodo Ramelow (Linke) und Matthias Platzeck (SPD) als neutrale Vermittler inszeniert. Doch beide stehen für Parteien, die in Regierungsverantwortung den öffentlichen Dienst ausgehöhlt und privatisiert haben. Sie vertreten nicht die Interessen der Arbeiter – sie sollen die reibungslose Funktionsfähigkeit des Staates sichern, koste es, was es wolle.
Derweil versucht der Berliner Senat unter Kai Wegner (CDU) Stimmung gegen die Streikenden zu schüren, in dem er die Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung beklagt – er verschweigt, worum es wirklich geht: Hungerlöhne, Überlastung und Personalmangel. Jahrzehntelange Sparpolitik haben die Infrastruktur zerschlissen. Die Arbeiter des BVG kämpfen deswegen nicht nur für bessere Löhne, sondern darüber hinaus für zuverlässige und sichere öffentliche Verkehrsmittel für die gesamte Bevölkerung!
. Jetzt, da sich die Arbeiter des öffentlichen Dienstes gegen diese Zustände wehren, zeigt sich die Politik empört – das ist pure Heuchelei!
Die aktuelle vereinbarte Schlichtung bedeutet ein Streikverbot bis zum 30. April. Doch der Funke ist entzündet, und der Staat reagiert auf diese brodelnde Unzufriedenheit.
Entwurf für Ausweitung der Schlichtungsverfahren – Angriff auf das Streikrecht
Während sich also die sozialen Spannungen in Deutschland verschärfen, zeigt die herrschende Klasse, dass sie sich auf kommende Konflikte vorbereitet – nicht durch Zugeständnisse, sondern durch Repression. Ein Gesetzesentwurf, der von Gesamtmetall, einem der einflussreichsten Unternehmerverbände, vorgelegt wurde, zielt darauf ab, das Streikrecht massiv einzuschränken. Dieser Entwurf ist ein Angriff auf eines der letzten effektiven Mittel der Arbeiterklasse: den kollektiven Arbeitskampf.
Kern des Gesetzes ist die Möglichkeit für Unternehmer, ein Schlichtungsverfahren einseitig einzuleiten – direkt nachdem eine Gewerkschaft ihre Tarifforderungen gestellt hat.
DasSchlichtungsverfahren wäre verbindlich – gegen den Willen der Arbeiter. Dieses Verfahren kann sich über Wochen hinziehen und wirkt wie ein gesetzlich verordnetes Streikverbot auf Zeit. Obwohl die Regierung das Gesetz noch nicht verabschiedet hat, ist dieser Entwurf ein klares Signal der Arbeitgeber, dass sie bereit sind, die Rechte der Arbeiter weiter einzuschränken, um ihre Interessen durchzusetzen.
Doch damit nicht genug: Auch sogenannte Warnstreiks sollen massiv eingeschränkt werden. Sie dürften künftig nur noch zwei Stunden dauern und im Abstand von sieben Tagen wiederholt werden. Gerade in frühen Phasen von Tarifrunden – wenn es darum geht, Kampfkraft aufzubauen – wäre das eine empfindliche Schwächung gewerkschaftlicher Taktik. Für Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Verkehr, Bildung oder Pflege kommen weitere Fesseln hinzu: Streiks müssten vier Tage im Voraus angekündigt und eine „angemessene Grundversorgung“ sichergestellt werden – ein juristisch dehnbarer Begriff, der faktisch ganze Streiks delegitimieren kann.
Ver.di bringt es auf den Punkt: „Ein Streikverbot durch die Hintertür.“ Und genau das ist es. In Zeiten, in denen Kapitalismus in der Krise ist, kann sich die Bourgeoisie keine kämpfenden Arbeiter leisten – sie braucht Ruhe, Disziplin, Kontrolle.
Doch kein Gesetz der Welt kann verschleiern, worauf diese Gesellschaft wirklich steht: Ob in der Industriehalle oder am Lenkrad des Busses, ob in der Pflege, an der Kasse oder in der Reinigung – es ist die Arbeiterklasse, die alles am Laufen hält. Produktion, Versorgung, Mobilität, Pflege, Bildung – das Leben funktioniert nur durch uns.
Die Linke als Streikpartei – Verantwortung übernehmen im Klassenkampf
Die geplanten Angriffe auf das Streikrecht müssen nicht nur verurteilt, sondern durch aktive Mobilisierung entschlossen bekämpft werden. Die Linke hat mit ihren jüngsten Wahlerfolgen und einem rasanten Mitgliederzuwachs – über 100.000 Menschen zählen inzwischen zur Partei – gezeigt, dass sie politisches Potenzial besitzt. Doch dieses Potenzial reicht nicht aus. In Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit, stagnierender Löhne und explodierender Konzernprofite braucht es eine Partei, die nicht nur verbal an der Seite der Beschäftigten steht, sondern mit ihnen kämpft – auf der Straße, in den Betrieben, in den Tarifrunden. Die Linke muss sich jetzt zur Streikpartei entwickeln – einer Partei, die Klassenkämpfe organisiert, zuspitzt und politisch begleitet.
Die Realität zeigt: Die deutschen Aufrüstungspläne gehen mit Kürzungen und Repression nach innen einher. Wer in diesem System nur auf parlamentarische Initiativen setzt, verkennt die Lage. Niedrige Tarifabschlüsse, Angriffe auf das Streikrecht und zunehmende staatliche Härte sind keine Zufälle – sie sind Ausdruck der systematischen Vorbereitung auf eine Verschärfung der Kürzungs- und Sparpolitik. Während Milliarden in Kriegsgerät fließen, werden zentrale Bereiche wie Bildung, Pflege oder Nahverkehr kaputtgespart. Wer diesen Zustand beenden will, muss Streiks nicht nur unterstützen, sondern als zentrale politische Strategie verstehen. Die Linke muss deshalb konsequent an der Seite kämpfender Beschäftigter stehen – in den aktuellen wie in den kommenden Tarifrunden.
Doch derzeit überlässt Die Linke die Bühne jenen, die keinen wirklichen Wandel wollen. Sie bleibt oft still, wenn Streiks sabotiert oder Kompromisse gegen die Interessen der Beschäftigten durchgedrückt werden. Die Folge: Andere bestimmen die Bedingungen – und das meist im Interesse des Kapitals. Will Die Linke eine Streikpartei sein, muss sie sich klar gegen solche faulen Deals positionieren, stattdessen Streikkomitees und Basisinitiativen stärken und eine politische Perspektive aufzeigen, die nicht auf Versöhnung, sondern auf Klassenkonflikt setzt.
Der Fall Ramelow zeigt exemplarisch, wohin es führt, wenn man „verantwortungsvoll“ die Krise des Kapitalismus verwalten will. Als Ministerpräsident agierte er nicht als Unterstützer der Interessen der Arbeiter, sondern als Bremser. Eine Bewegung ist für einen „verständnisvollen“ Politiker nur solange hilfreich, soweit sie ihn in eine Verhandlungsposition hebt – indem sie zur Wahlurne geht oder den Verhandlungstisch in einer Tarifrunde vorbereitet. Danach ist eine kämpferische Bewegung für ihn eine Last, denn er versteht die „Sorgen und Nöte“ der Unternehmer gut.
Die Aufgabe einer Streikpartei besteht genau im Gegenteil: Kämpfe befeuern, nicht abwürgen; Niederlagen analysieren, nicht beschönigen; Organisation und politische Klarheit schaffen, statt Verwirrung und Frust.
Diese Entwicklung ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer politischen Linie, die auf Kompromiss um jeden Preis setzt – selbst wenn dieser Preis der Rückzug der eigenen Basis ist. Doch wer die Auseinandersetzung mit dem Kapital scheut, kann keine politische Kraft aufbauen. Die Linke muss sich von einer Partei der Appelle zu einer Partei der Aktion wandeln. Das bedeutet: Sich mit Streikenden vernetzen, Kampagnen zum Aufbau gewerkschaftlicher Basisstrukturen starten, konkrete Streikunterstützung leisten – finanziell, organisatorisch, medial – und Streiks als politische Kämpfe sichtbar machen.
Wenn Die Linke in dieser entscheidenden Phase keine klare, kämpferische Haltung einnimmt, wird sie nicht nur irrelevant, sondern macht sich mitschuldig am Rückzug der Arbeiterbewegung. Jetzt ist der Moment, die Rolle einer echten Streikpartei einzunehmen: parteilich, entschlossen und mit dem Ziel, die Kräfteverhältnisse zu verändern – nicht zu verwalten.
Als RKP unterstützen wir jeden Schritt, den Die Linke unternimmt, um die Arbeiterkämpfe zu stärken. Aber wenn Die Linke wirklich gegen Aufrüstung und Kürzungen kämpfen will, muss sie die politische Stimme der Streikenden werden. Sie muss ihr Gewicht als Massenpartei hinter die Streiks werfen, die Mobilisierung ihrer Mitglieder vorantreiben und einen Zusammenschluss der Streiks aktiv vorantreiben. Sie muss ihre Medienaufmerksamkeit nutzen, um vor den Angriffen auf das Streikrecht zu warnen und die Arbeiterklasse in diesem Kampf zu stärken.
Um eine Partei zu schaffen, die bedingungslos die Interessen der Arbeiter vertritt und sich nicht durch die parlamentarische Bühne lähmen lässt, braucht es den Marxismus als fundamentale Grundlage. Die RKP kämpft nicht nur gegen die Auswirkungen des kapitalistischen Systems, sondern auch gegen die Illusion eines Klassenkompromisses – d. h. durch vorauseilende Zugeständnisse an die Kapitalisten hofft man auf eine Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse. Hierdurch wird immer wieder die Kampfkraft geschwächt und eine Niederlage vorbereitet. . Die RKP ist eine politische Kraft, die bedingungslos die Interessen der Arbeiter verteidigt und konsequent gegen die reaktionären Kräfte der herrschenden Klasse ankämpft. Deswegen kämpfen wir für Reformen und die revolutionäre Transformation der Gesellschaft, um das kapitalistische System zu überwinden.
Gegen den fortschreitenden Sozialabbau, das Lohndumping, die zunehmende Wohnungsnot und die Kriegstreiberei hat Die Linke das Potenzial, zur treibenden Kraft einer revolutionären sozialen Bewegung zu werden. Aber dafür muss sie eine klare Entscheidung treffen: sich mit voller Kraft auf die Seite der Arbeiterklasse stellen!
- Kein Opfer für die Krise des Kapitals – keine Zugeständnisse an die Kriegspolitik!
- Für eine Bewegung gegen Sozialabbau, Ausbeutung und Aufrüstung – hier und weltweit!